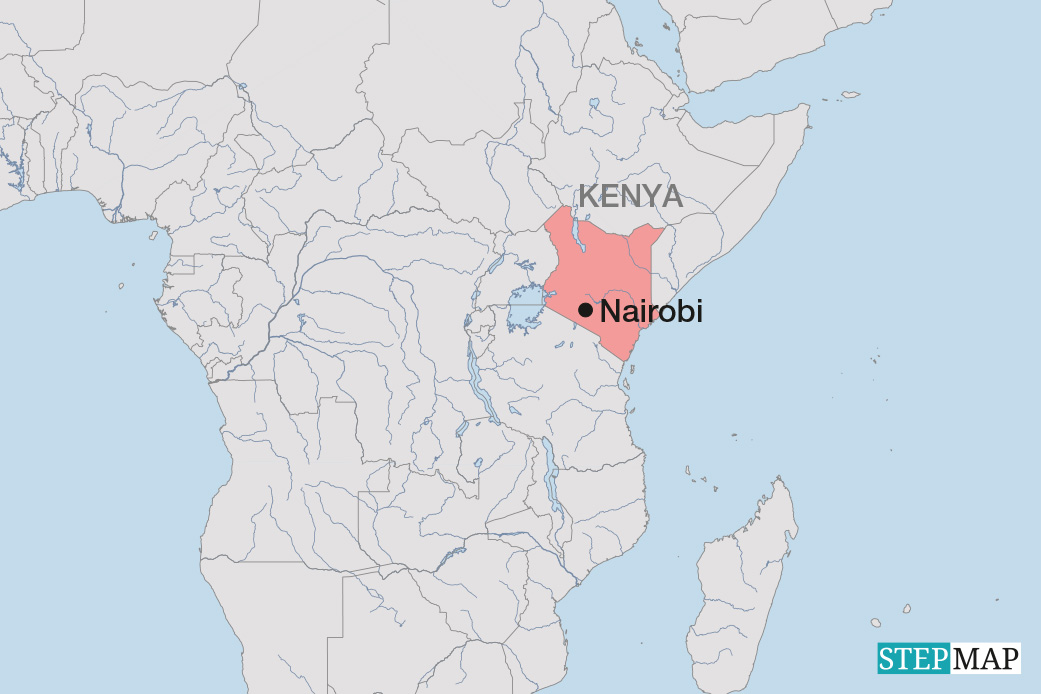Staatliche Repression
„So behandelt man nicht einmal Kriminelle“

Mehrere Monate sind vergangen, seit Agather Atuhaire und der kenianische Aktivist Boniface Mwangi von tansanischen Sicherheitskräften entführt wurden. Die beiden waren im Land, um den Prozess gegen den Oppositionsführer Tundu Lissu zu beobachten, der zurzeit wegen Hochverrats angeklagt ist. Zusammen mit Mwangi hat Atuhaire beschlossen, öffentlich über die Misshandlungen zu sprechen, die sie während ihrer Verschleppung erfahren hat. Bei einer Pressekonferenz mit internationalen Medien im Juni beschuldigten sie die Sicherheitskräfte der physischen und sexuellen Folter, einschließlich Vergewaltigung. Ihre Aussagen werden durch die Dokumentation internationaler Menschenrechtsorganisationen gestützt und stehen im Mittelpunkt eines derzeit vor dem Ostafrikanischen Gerichtshof verhandelten Rechtsstreits. Kurz nach der Entführung erklärte die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan öffentlich, sie werde nicht tolerieren, dass ausländische Aktivist*innen in das Land „einfallen“ und es destabilisieren. Mwangi und Atuhaire verklagen die Regierung Tansanias wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück.
Tansania wurde in Uganda traditionell als gastfreundliches Land mit einer progressiven Verfassung angesehen, doch auch hier hat sich die Menschenrechtslage – wie in ganz Ostafrika – mittlerweile erheblich verschlechtert. Prominente Personen der ugandischen Opposition sind ebenfalls Ziel von grenzüberschreitenden Entführungen und Einschüchterungen geworden – darunter etwa Kizza Besigye, der während eines Besuchs in Kenia festgenommen wurde. In Uganda bestätigte Präsident Yoweri Museveni kürzlich, dass zwei kenianische Aktivisten, die seit fünf Wochen in seinem Land vermisst wurden, festgenommen worden sind.
Diese Vorfälle stehen beispielhaft für ein größeres Muster der Unterdrückung in der Region. Tansania befindet sich nach den Wahlen im Oktober, die laut der Afrikanischen Union keine demokratischen Standards erfüllten, in Aufruhr. In der Folge kam es zu weit verbreiteten Gewaltausbrüchen mit mutmaßlich hunderten Todesopfern. In Kenia wurden bei Protesten gegen die Regierung im zweiten Jahr in Folge zahlreiche Menschen Opfer von Polizeigewalt. In Uganda bestehen seit Jahrzehnten Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Journalist*innen sind dort oft Gewalt, willkürlichen Verhaftungen und rechtlicher Schikane ausgesetzt. Laut dem Weltindex für Pressefreiheit 2025 liegt Uganda auf Platz 143 von 180 Ländern, Kenia auf Platz 117 und Tansania auf Platz 95.
Ihre Arbeit als Journalistin, Anwältin und Aktivistin konzentriert sich auf die Förderung von Menschenrechten, staatlicher Rechenschaftspflicht und sozialer Gerechtigkeit. Durch Ihre solidarische Zusammenarbeit mit anderen haben Sie dazu beigetragen, marginalisierten Gemeinschaften eine Stimme zu geben. Wie hat die jüngste traumatische Erfahrung von Gewalt in Tansania Ihre Sichtweise auf Aktivismus und Gerechtigkeit verändert?
Zuallererst war sie extrem traumatisierend. Das Schlimmste ist, dass man gar nichts getan hat und trotzdem nichts unternommen wird. So behandelt man nicht einmal Kriminelle. Es sollte Gesetze und ein ordentliches Verfahren geben. Hinterher hatte ich mit einem Gefühl der Ohnmacht zu kämpfen. Es gab keine Konsequenzen, keine Rechenschaft. Man fügt anderen Menschen Leid zu und geht dann seiner Wege, während die Opfer verletzt und verzweifelt zurückbleiben. Die einzige Hoffnung war, dass unsere Tortur anderen helfen würde, die keine Plattform und keine Stimme haben. Aber trotz unserer Reichweite änderte sich nichts, was schockierend und entmutigend war. Ich bewundere vieles an den Kulturen Ugandas und Tansanias, aber unsere Folter hat gezeigt, wie tief Gewalt und Straflosigkeit in ihren Systemen verwurzelt sind. Ein Freund sagte mir, dass das, was uns passiert ist, für Tansanier*innen zum „Tagesgeschäft“ gehöre, was mir das Ausmaß des Problems bewusst machte. Unsere Tortur hat mich davon überzeugt, wie wichtig es ist, die Realität in Tansania offenzulegen – insbesondere die Taten von Präsidentin Samia Suluhu Hassan. Sie kam als Symbol der Hoffnung für marginalisierte Gemeinschaften an die Macht, doch sie hat es versäumt, diese zu vertreten oder zu schützen. Sie regiert wie eine Diktatorin.
Wie ist Ihre Meinung zu Präsidentin Hassan als weibliche Führungspersönlichkeit?
Ich halte nichts davon, den Aufstieg einer Frau in eine Machtposition nur um der Repräsentation willen zu feiern. Wenn ich Frauen in Führungspositionen kritisiere, die sich missbräuchlich verhalten, stoße ich auf Widerstand – sogar von Männern, die sagen, wir sollten Machthaberinnen einfach begrüßen. Aber das genügt nicht. Für mich zählt, ob sie sich für die Rechte aller Frauen einsetzen und systemischen Missbrauch bekämpfen. Im Fall von Präsidentin Hassan sehe ich dafür kaum Anhaltspunkte. Ihr Ansatz geht nicht sinnvoll auf die Probleme von Frauen ein und bleibt innerhalb patriarchalischer Normen und Praktiken. Ihre Reaktion auf Kritik war ebenfalls enttäuschend. Anstatt Rechtsverstöße über die richtigen Kanäle anzugehen, gab sie zwar administrative Verfehlungen zu, schob aber die Verantwortung auf externe Akteure. Dies spiegelt ein allgemeines Muster in Afrika wider, wo Frauen in Führungspositionen oft bestehende patriarchalische Strukturen reproduzieren. Wir haben Machthaberinnen, aber nur sehr wenige sind Reformerinnen. Viele setzen einfach Missbrauch oder Korruption fort, und das ist kein wirklicher Fortschritt für Frauen.
Ihre Familie hat alle möglichen Wege beschritten, um die ugandische Regierung dazu zu bewegen, eine offizielle Ermittlung zu Ihrem Verschwinden einzuleiten. Die Ugandan High Commission hat daraufhin am 22. Mai 2025 ein Ersuchen an die Kriminalpolizei Tansanias gerichtet. Wie ist Ihre Familie mit dem umgegangen, was Ihnen widerfahren ist?
Ich wollte meine Familie aus der Sache heraushalten, aber sie hat am meisten gelitten, vor allem während der Zeit, in der ich vermisst wurde. Meine Schwester stand kurz vor einem Zusammenbruch. Meine schon etwas ältere Mutter, die auf dem Land lebt, musste vor den Einzelheiten der Geschehnisse abgeschirmt werden. Mein jüngster Sohn litt danach unter gesundheitlichen Problemen. Er war monatelang krank, und die Ärzt*innen führten es auf stressbedingte Immunprobleme zurück. Meine Familie hat mich unterstützt, und ein Teil meines Heilungsprozesses besteht darin, ihnen nahe zu sein – dafür zu sorgen, dass sie sich wieder sicher fühlen. Meine Kinder verstehen meinen Aktivismus nicht vollumfassend. Für sie geht es darum, dass ihre Mutter ungerecht behandelt wird. Sie begreifen nicht unbedingt den gesamten Zusammenhang.
Die Außenpolitik Ugandas wurde wegen fehlender wirksamer Mechanismen zum Schutz von Bürger*innen im Ausland und der unklaren Nutzung regionaler Rahmenwerke zur Bekämpfung von Ungerechtigkeiten kritisiert. Diplomatische Gesten – wie beispielsweise der Empfang des stellvertretenden tansanischen Ministers für auswärtige Angelegenheiten und ostafrikanische Zusammenarbeit durch den ugandischen Hochkommissar in Daressalam zur Feier der „regionalen Bindungen“ – scheinen Vorrang zu haben, ohne dass Ihr Fall dabei erwähnt wird. Haben Sie das Gefühl, dass die ugandische Regierung Sie unterstützt hat? Und was bedeutet in diesem Kontext Gerechtigkeit für Sie?
Bis jetzt bin ich von der Regierung noch nicht darauf angesprochen worden, was mir passiert ist. Gerechtigkeit wird unter diesen Umständen zu einem persönlichen Prozess. Institutionelle Gerechtigkeit ist selten, also lernt man, in den Schritten, die man selbst unternehmen kann, einen Sinn zu finden. Es ist schwierig und manchmal deprimierend, abzuwägen, ob es das persönliche Risiko wert ist, Kriminelle zu entlarven. Handeln führt nicht immer zu Solidarität. Nicht jeder zeigt Interesse oder stimmt zu. Aber ich leiste weiterhin meinen Beitrag, denn Schweigen würde mich mitschuldig machen.
Ich erwarte keine rechtliche Wiedergutmachung durch nationale Institutionen. Sie sind zu stark kompromittiert. Dennoch haben wir einen formellen Prozess vor dem Ostafrikanischen Gerichtshof angestrengt und warten derzeit auf den Verhandlungstermin. Auch wenn diese Verfahren lange dauern und meist nur symbolischen Charakter haben, sind sie notwendig, bevor man Fälle vor internationale Instanzen wie die UN bringen kann.
Welche Rolle spielt die internationale Gemeinschaft?
Die internationale Gemeinschaft scheint sich immer weniger für die Menschenrechte in Afrika zu interessieren; der Fokus hat sich auf Handel und Wirtschaft verlagert. Afrika ist heute ein Schauplatz des Kampfs um Einfluss zwischen dem Westen, China und Russland. Weder China noch Russland zeigen irgendein Interesse an Menschenrechten; ihr Engagement ist rein geschäftlicher Natur. Gleichzeitig sind die vom Westen bereitgestellten Mittel für Demokratie und Zivilgesellschaft zurückgegangen, und lokale Aktivist*innen sehen sich neuen transnationalen Bedrohungen ausgesetzt. Menschenrechtsverteidiger*innen sind heute viel weniger sicher als früher, da die internationale Aufmerksamkeit nachgelassen hat.
Kenianische Aktivist*innen spielten eine Schlüsselrolle bei der Bekanntmachung Ihrer Entführung, während die Zivilgesellschaft in Uganda weitgehend schwieg. Bis heute haben weder die Uganda Human Rights Commission noch die Uganda Law Society – deren Mitglied Sie sind – eine öffentliche Solidaritätserklärung abgegeben. Was sagt das über den Zustand der Zivilgesellschaft in Uganda aus? Gibt es aktive Bewegungen?
In Uganda gibt es eine Zivilgesellschaft, aber sie nimmt nicht immer eine organisierte Form an. Was wir haben, ist eher eine organische Bewegung – Menschen knüpfen informelle Kontakte, nehmen an Treffen teil, und das Netzwerk wächst auf natürliche Weise. Wir haben über eine Formalisierung und die Beschaffung von Finanzmitteln diskutiert, aber derzeit ist alles noch recht informell – und trotzdem wirkungsvoll. In den letzten zwei Jahren habe ich echte Fortschritte gesehen, insbesondere durch die sozialen Medien. Was früher ein Ort für beiläufige Gespräche war, ist zu einem mächtigen Instrument für Organisation und öffentliche Bildung geworden. Das ist besonders bei jungen Menschen wirksam. Der Schwerpunkt liegt nun darauf, korrekte Informationen zu verbreiten und Menschen so einzubinden, dass sie von passiven Beobachtenden zu aktiven Teilnehmenden werden.
Agather Atuhaire ist eine ugandische Anwältin, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, die für ihre investigativen Berichte über Korruption und Regierungsführung bekannt ist. Sie leitet das AGORA Center for Research und hat internationale Auszeichnungen erhalten, darunter den EU-Menschenrechtspreis 2023 und den International Women of Courage Award 2024 des US-Außenministeriums.
euz.editor@dandc.eu