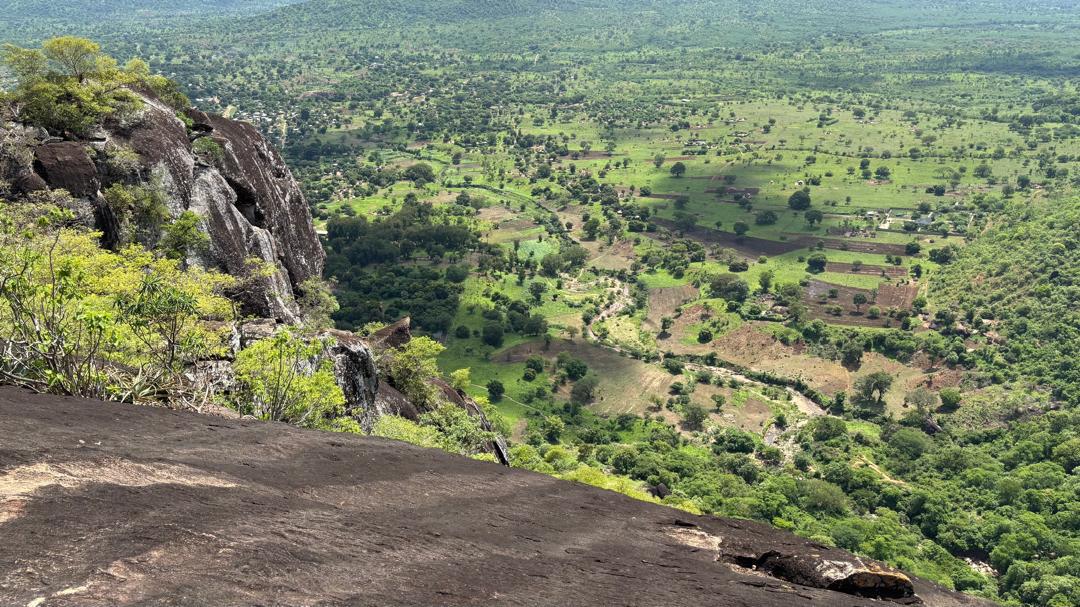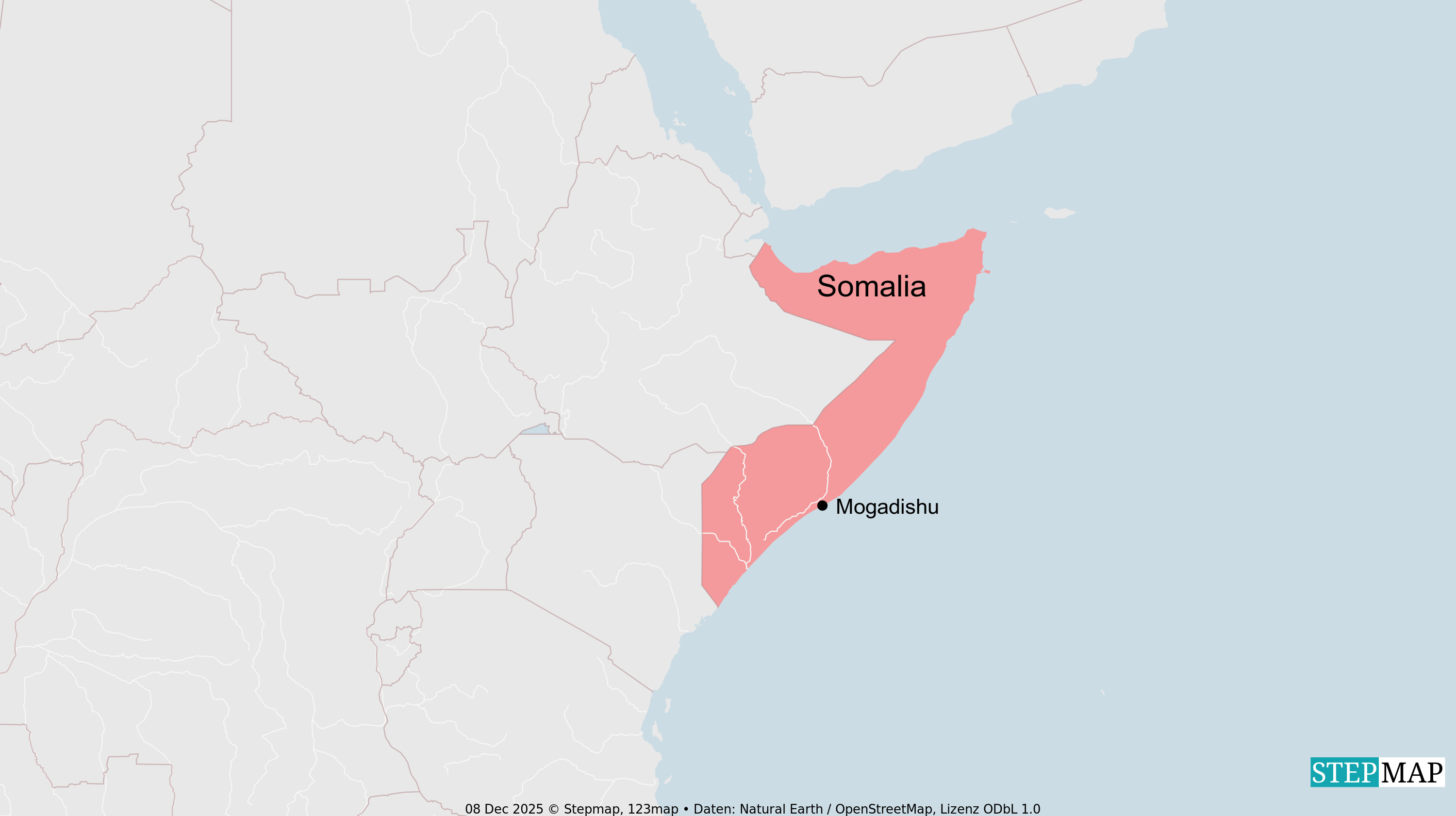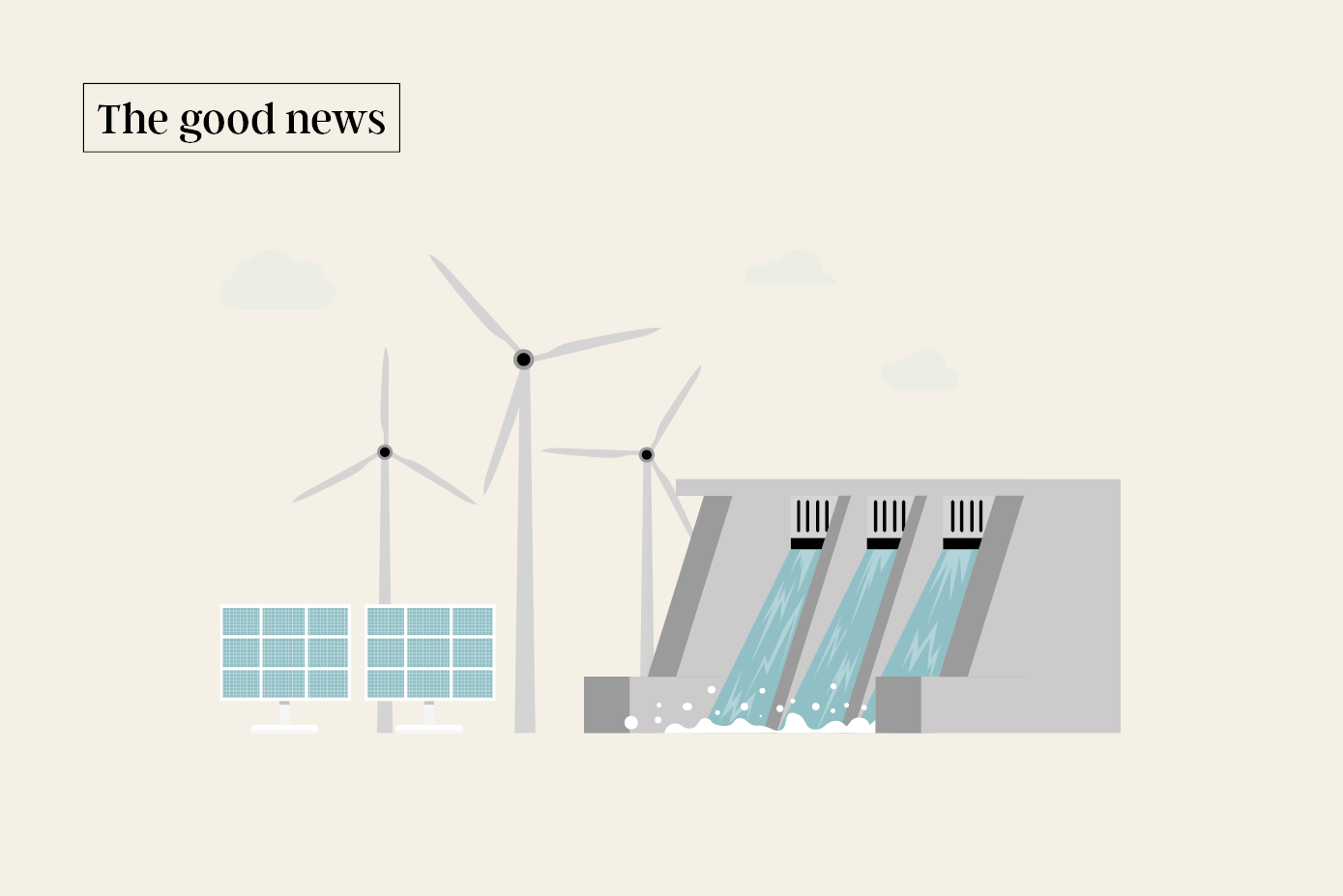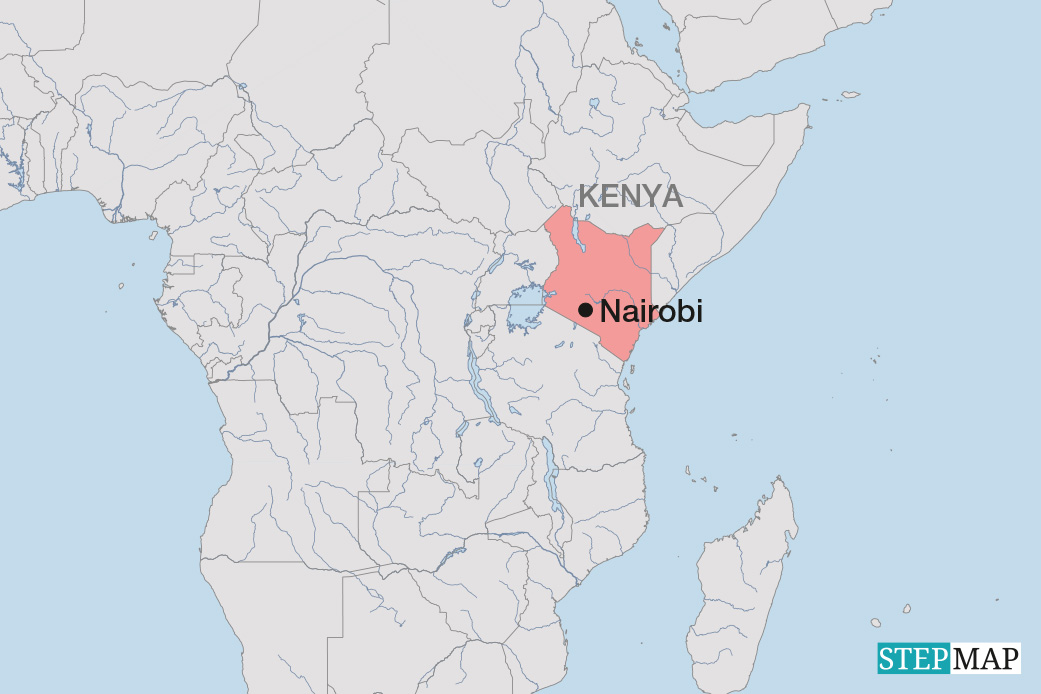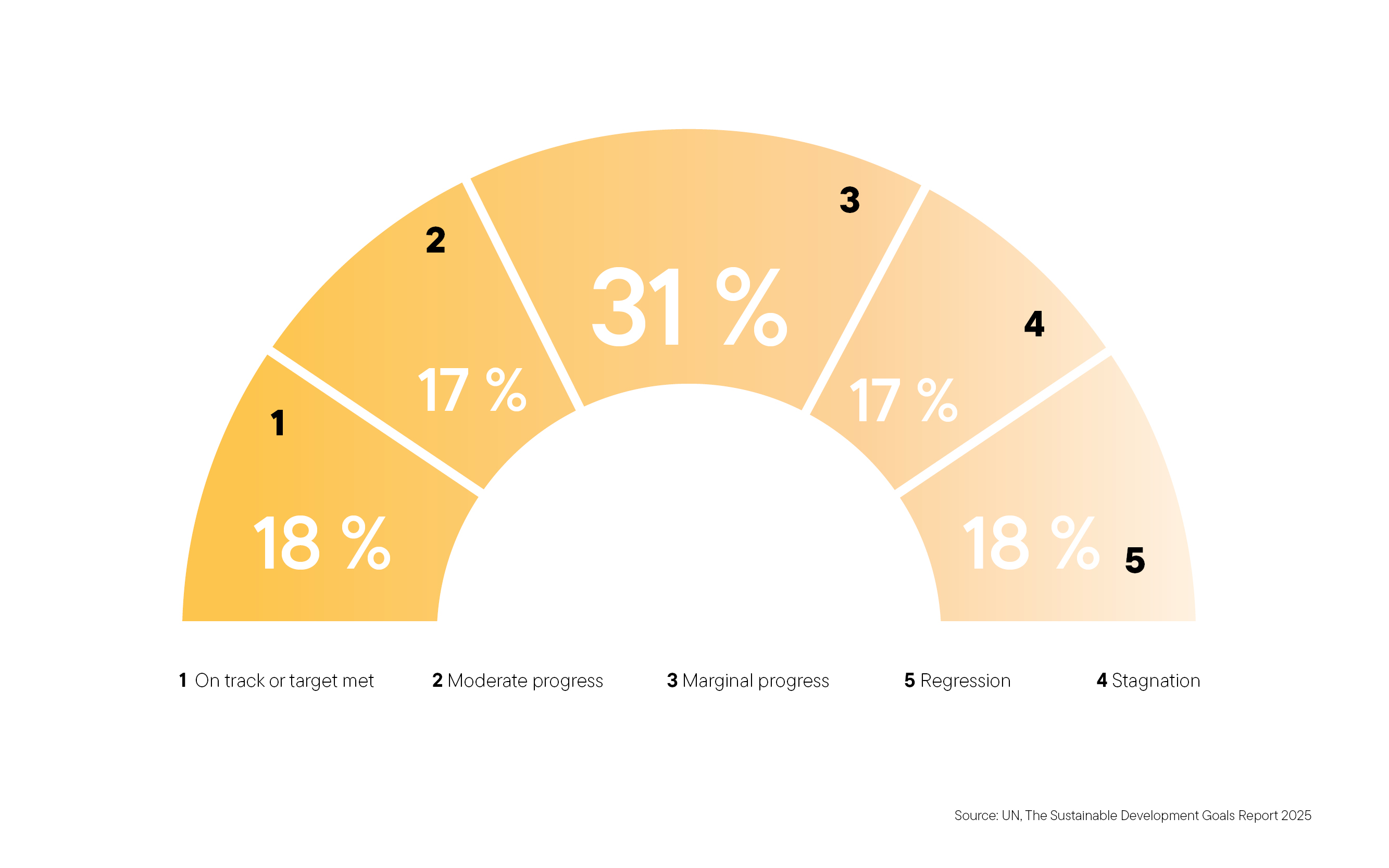Kolumbien
Wie Kolumbien Millionen vertriebene Venezolaner*innen aufgenommen hat

Beginnen wir mit den Zahlen: Aus keinem Land waren Ende 2024 mehr Menschen geflohen als aus Venezuela. Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) leben 6,5 Millionen Venezolaner*innen in anderen Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Seit dem Einbruch der Ölpreise 2014 kam es in Venezuela zu Hyperinflation, Lebensmittel- und Medikamentenknappheit, die Gesundheitsversorgung und andere öffentliche Dienstleistungen verschlechterten sich, die Kriminalität stieg massiv an, und zugleich ging die zunehmend autoritäre Regierung brutal gegen jede Opposition vor.
Bei der dadurch ausgelösten Fluchtbewegung spricht UNHCR von „einer der größten Vertreibungskrisen in Lateinamerika“. Kein anderes Land hat mehr geflüchtete Venezolaner*innen aufgenommen als das Nachbarland Kolumbien, dessen Grenze seit 2014 von Millionen venezolanischen Bürger*innen auf der Suche nach Schutz überquert worden ist. Damit belegt Kolumbien weltweit nun Platz drei der größten Aufnahmeländer für Geflüchtete.
Aber auch Schutzsuchende aus anderen lateinamerikanischen Ländern kommen nach Kolumbien, viele davon auf der Durchreise in die USA. Insbesondere seit Beginn der Covid-Pandemie im Jahr 2020 ist die Transitmigration aus anderen südamerikanischen Ländern wie Ecuador, aus der Karibik, Asien und Afrika angestiegen. Knapp 3 Millionen internationale Geflüchtete leben aktuell in Kolumbien – eine große Aufgabe für ein Land, das auch ohne die Fluchtkrise schon einige Probleme zu bewältigen hätte.
Ein Vorbild für die Nachbarstaaten
Dennoch hat Kolumbien im Vergleich zu anderen Ländern in der Region besser auf die Flucht- und Migrationskrise reagieren können. Einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass Kolumbien bereits Erfahrung im Umgang mit Geflüchteten hat. Schließlich belegt Kolumbien noch in einer weiteren internationalen Statistik den dritten Platz: Kolumbien ist das Land mit den drittmeisten Binnenvertriebenen. Der jahrzehntelange bewaffnete Konflikt dauert bis heute an – trotz eines Friedensabkommens, das 2016 zwischen der Regierung und der Guerillagruppe FARC geschlossen wurde. Zusammenstöße zwischen bewaffneten Gruppen führen weiterhin zu Zwangsvertreibungen, und so zählten Ende 2024 rund 7 Millionen Kolumbianer*innen als Binnenvertriebene und benötigten Schutz.
Kolumbien hatte also bereits institutionelle und administrative Kapazitäten aufgebaut, um auf die humanitären Bedürfnisse von Geflüchteten zu reagieren – das Land hatte einen langen Prozess des Lernens, der Anpassung und der Reaktion durchlaufen.
Als Antwort auf die venezolanische Fluchtkrise hat Kolumbien 2021 eine interessante Initiative ins Leben gerufen. Der Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (vorübergehender Schutzstatus für venezolanische Migrant*innen – EPTV) ermöglicht es venezolanischen Migrant*innen, ihren Status zu legalisieren. Sie dürfen sich bis zu zehn Jahre lang in Kolumbien aufhalten, bevor sie eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen müssen, und erhalten eine Arbeitserlaubnis sowie Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung. Alle Venezolaner*innen, die sich bereits im Land befanden – ob legal oder illegal – und diejenigen, die zwischen Februar 2021 und Mai 2023 legal eingereist sind, konnten den EPTV beantragen und erhielten den Permiso por Protección Temporal (PPT), ein Dokument, das einer Aufenthaltsgenehmigung ähnelt. Mit dem PPT können Venezolaner*innen sich an lokale und regionale Behörden wenden, um Zugang zu verschiedenen Unterstützungsprogrammen zu erhalten.
Obwohl der EPTV nicht perfekt war, hat er den Venezolaner*innen ermöglicht, sich in Kolumbien ein Leben aufzubauen und Zugang zum sozialen Sicherungsnetz zu erhalten. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) trugen venezolanische Migrant*innen im Jahr 2022 529,1 Millionen Dollar zur kolumbianischen Wirtschaft bei, was fast zwei Prozent der gesamten Steuereinnahmen des Landes entspricht. Die IOM geht davon aus, dass die Venezolaner*innen dank der EPTV-Initiative in den kommenden Jahren noch mehr beitragen werden.
Andere Geflüchtete sind weniger geschützt
Mit dem EPTV-Programm ist Kolumbien ein Vorbild für den Kontinent. Wie immer jedoch schaffen Regulierungen und Gesetze auch Grenzen. Alle, die nicht unter die oben genannten Kategorien fallen, bleiben in der Schwebe.
Dazu gehören insbesondere alle Menschen, die aus anderen Ländern als Venezuela Zuflucht suchen. Die meisten von ihnen müssen als Geflüchtete anerkannt werden, um einen legalen Status in Kolumbien zu erlangen. Die rechtliche Definition von Geflüchteten ist jedoch strenger, was den Anerkennungsprozess erschwert. Geflüchtete sind in Kolumbien im Allgemeinen weniger geschützt und haben durchweg schlechteren Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeit.
Für Migrant*innen und Geflüchtete ist es nicht immer einfach – auch für die Venezolaner*innen nicht. Sie werden von der Gesellschaft stigmatisiert, fälschlicherweise mit mehr Kriminalität in Verbindung gebracht und als weniger beschäftigungsfähig, faul oder weniger unterstützungswürdig betrachtet. In einem Land mit einem hohen Maß an Informalität und Prekarität konkurrieren sie mit den Kolumbianer*innen um die Unterstützung des Staates.
Kolumbien ist zudem ein Land, in dem bewaffnete Konflikte andauern und das derzeit eine besorgniserregende Gewaltzunahme verzeichnet. Migrant*innen und Geflüchtete in Kolumbien sind zunehmend von Gewalt und Vertreibung betroffen und laufen ein höheres Risiko, von Mafiagruppen und bewaffneten Gruppen ausgebeutet zu werden. Berichte veranschaulichen, dass Mafiagruppen de facto die Migrationsrouten von Lateinamerika in die USA kontrollieren. Migrant*innen können von bewaffneten Gruppen missbraucht werden oder sich im Kreuzfeuer wiederfinden – und Kolumbien bildet hier keine Ausnahme.
Die USA und ihre Kanonenbootdiplomatie
Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund, weshalb Kolumbien vorbildlich auf die Vertreibungskrise reagiert hat – und das ist politischer Wille. Kolumbien war politisch gesehen immer ein rechtsgerichtetes Land. Die Regierungen hegten eine starke Abneigung gegen das venezolanische Regime und haben Geflüchtete aus Venezuela eher willkommen geheißen.
Die derzeitige Regierung von Gustavo Petro hat nun einen anderen Ton angeschlagen. Petro, der 2022 als erster linksgerichteter Präsident in der Geschichte Kolumbiens sein Amt antrat, will die Spannungen mit Venezuela abbauen. Diese Positionsänderung hat die Unterstützung für Migrationsprogramme gesenkt, was durch die Kürzungen der USAID-Mittel für humanitäre Programme noch verstärkt wird. Letztendlich hängt der Schutz von Migrant*innen und Geflüchteten immer auch von der internationalen Politik ab.
Da die USA kürzlich im Rahmen ihrer Kanonenbootdiplomatie Kriegsschiffe vor Venezuela stationiert haben und weiterhin hart gegen Migrant*innen und Geflüchtete vorgehen, die in die USA kommen, bleibt abzuwarten, ob diese Spannungen den Zustrom von Venezolaner*innen verstärken werden. Sollte es deshalb zu einer Rückwanderung von Migrant*innen kommen, die sich bereits auf dem Weg in Richtung USA befinden, wird dies das Land vor neue Herausforderungen stellen. Erstmal aber lässt sich festhalten: Kolumbien ist ein Beispiel für einen Staat, der sich trotz eigener Probleme dafür entschieden hat, sich für die Menschlichkeit einzusetzen.
Fabio Andrés Díaz Pabón ist wissenschaftlicher Mitarbeiter zu den Themen nachhaltige Entwicklung und Afrikanische Agenda 2063 am African Centre of Excellence for Inequality Research (ACEIR) an der Universität Kapstadt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politik und Internationale Studien der Rhodes University.
fabioandres.diazpabon@uct.ac.za