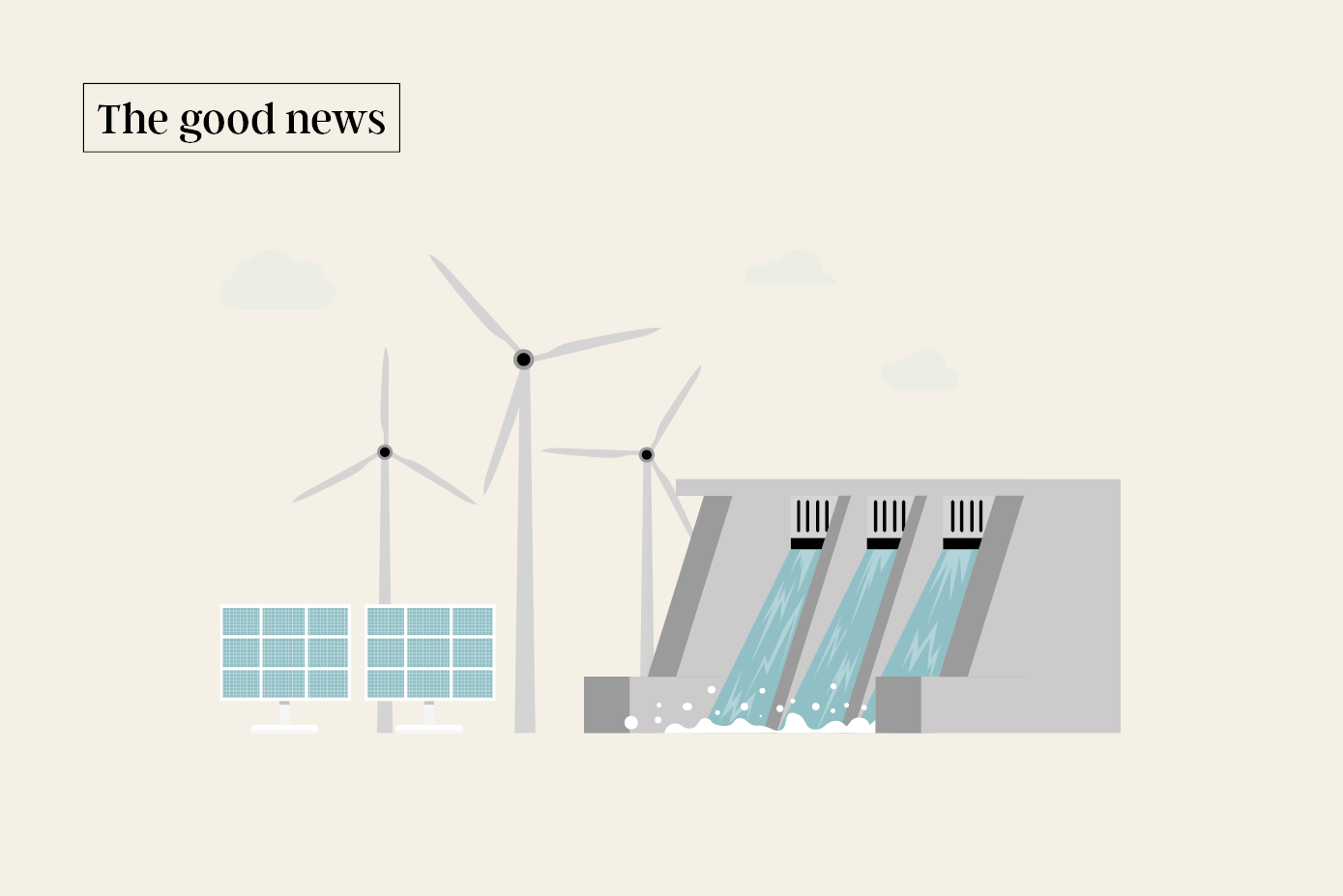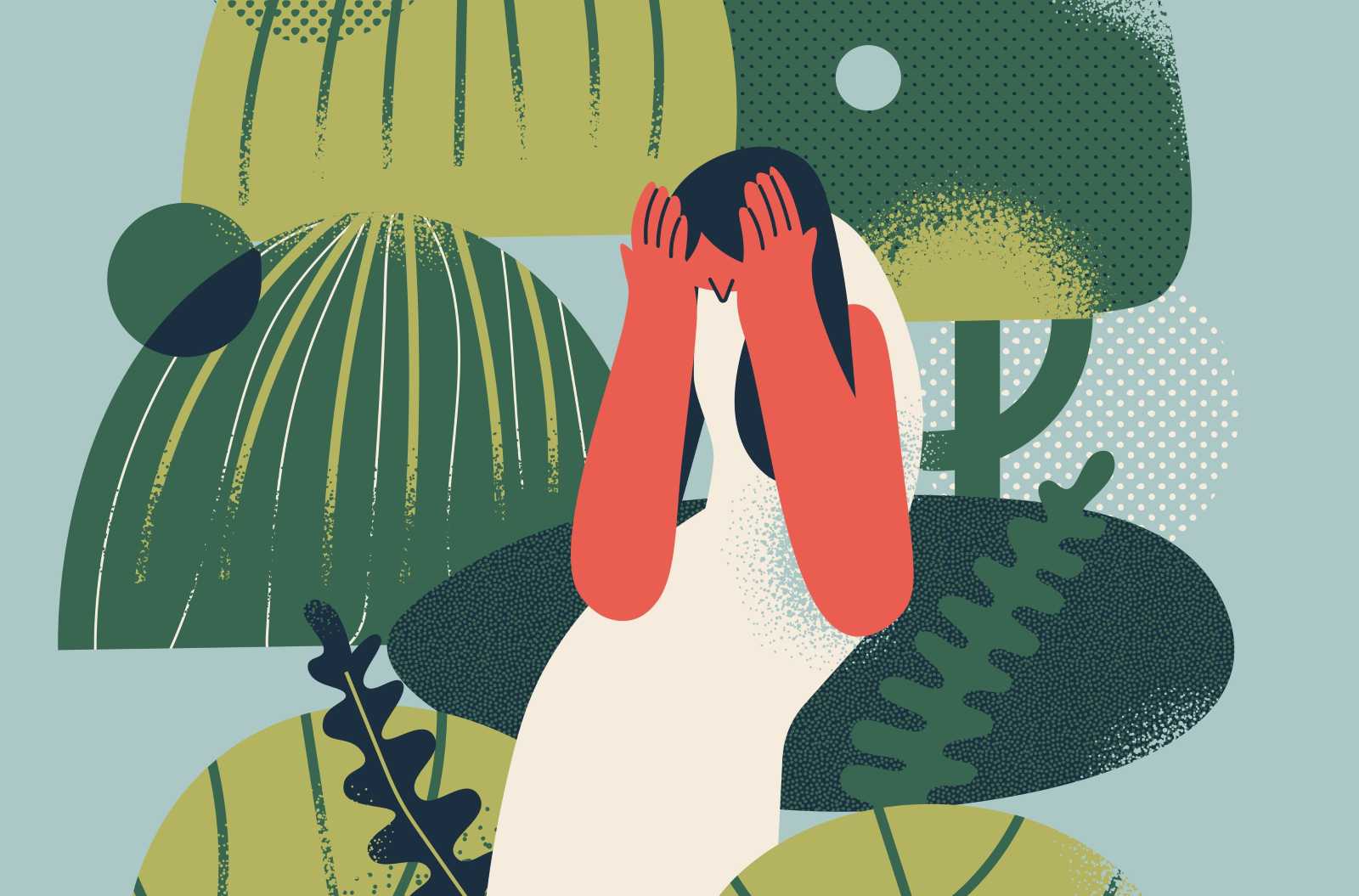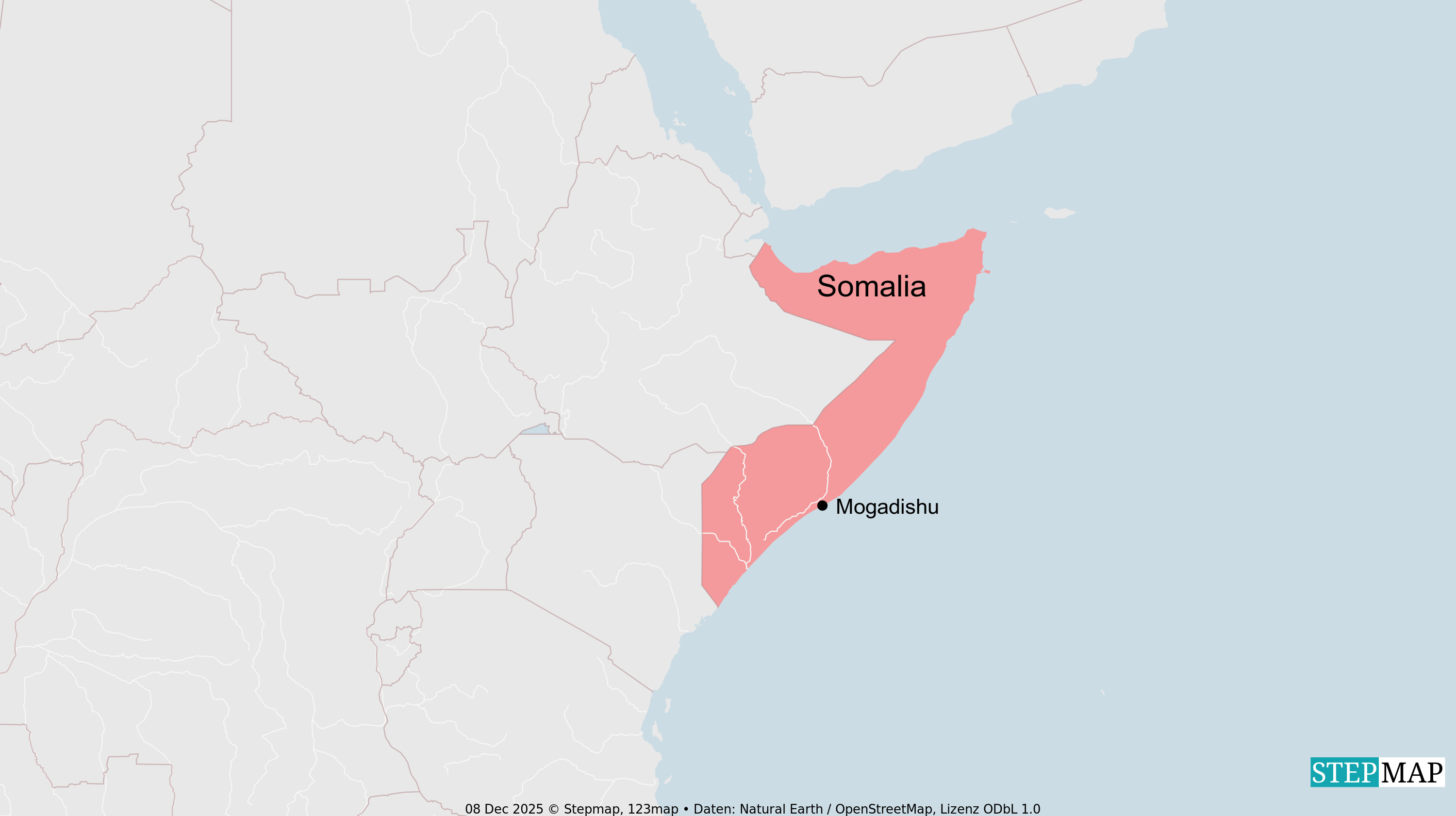Südamerika
Der Ruf nach autoritärer Führung wird lauter

Südamerika steht zwischen zwei Superwahljahren, und ein Trend zeichnet sich bereits ab: Die Wahlergebnisse in Bolivien, Chile und Argentinien aus dem Jahr 2025 deuten auf ein Erstarken des Populismus und einen Rechtsruck hin. Bei den Wahlen in Peru, Kolumbien und Brasilien im Jahr 2026 könnten ähnliche Ergebnisse bevorstehen. Mehrere südamerikanische Länder scheinen kurz vor einer autoritären Wende zu stehen.
Warum ist das so? Das Beispiel Peru veranschaulicht, welche Dynamiken im Spiel sind. Es zeigt, wie anhaltende Ungleichheiten, der Verfall staatlicher Institutionen und die Militarisierung der Politik Rechtspopulismus und autoritäre Lösungen befeuern. In den vergangenen Monaten kam es zu massiven Protesten und politischen Spannungen – und im April wird gewählt.
Ungleichheit führt zu Instabilität
Peru ist ein mahnendes Beispiel dafür, dass wirtschaftlicher Aufschwung nicht gleich politischen Fortschritt bedeutet. Das Land verzeichnete zwei Jahrzehnte lang überdurchschnittliches Wachstum und wurde 2022 eingeladen, sich als Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu bewerben. Der peruanische „Sol“ zählte 2025 zu den stärksten Währungen Südamerikas, das Land zu den größten Empfängern ausländischer Direktinvestitionen in der Region.
Trotzdem ist die politische Instabilität groß – in den vergangenen neun Jahren hatte das Land sieben Präsident*innen. Laut dem peruanischen Soziologen Julio Cotler haben die lokalen Eliten seit jeher vom Export natürlicher Ressourcen profitiert und Gewinne für sich eingestrichen. Diese Dynamik hat die staatlichen Institutionen geschwächt und Ungleichheiten verstärkt.
Perus Krise ist letztlich eine Krise der politischen Repräsentation. Das Parlament wird von Eliten dominiert, die kurzfristige Eigeninteressen verteidigen. Statt gegen Kriminalität vorzugehen oder staatliche Institutionen zu stärken, haben sie Steuererleichterungen für Konzerne beschlossen und den Bergbau nicht ausreichend reguliert, was die weitere Abholzung des Amazonasgebiets ermöglicht.
Politische Parteien werden daher zunehmend als Treiber von Unsicherheit, Korruption und Straflosigkeit gesehen – nicht als jene, die sozialen Ausgleich vorantreiben. Das hat landesweit Unmut und Proteste ausgelöst, besonders bei der Generation Z.
Proteste dienen als Rechtfertigung für staatliche Gewalt
Die Empörung der Öffentlichkeit wurde so groß, dass die ehemalige Präsidentin Dina Boluarte 2025 zurücktreten musste. José Jerí übernahm als Interimspräsident das Amt. Der Boluarte-Regierung war es nicht gelungen, Unsicherheit und Straflosigkeit einzudämmen – vielmehr wurde ihr selbst ständig Korruption vorgeworfen. Zwischen Januar und September wurden schätzungsweise rund 50 Busfahrer*innen von Kriminellen und bewaffneten Banden ermordet; immer wieder legten Transportstreiks Lima lahm. Auch wurde Boluarte nie zur Rechenschaft gezogen für die Anwendung übermäßiger Gewalt und den Tod von Demonstrierenden zu Beginn ihrer Präsidentschaft im Jahr 2022.
Im Oktober 2025 eskalierte die Krise. Bei Massenprotesten gegen Jerís Amtseinführung wurde der Rapper und Straßenkünstler Trvko von einem Polizisten erschossen, was noch mehr Empörung auslöste. Jerí rief daraufhin den Ausnahmezustand aus und setzt seitdem Soldaten auf den Straßen ein, um die Unsicherheit zu bekämpfen. Dabei zeigen Erfahrungen aus dem Nachbarland Ecuador, dass solche Maßnahmen nicht zielführend sind. Dort hatte der Präsident vor zwei Jahren verkündet, das Land befinde sich in einem „internen bewaffneten Konflikt“, und den Ausnahmezustand ausgerufen. Allerdings sank dadurch die Mordrate nicht; vielmehr nahmen Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte zu.
Sicherheit ist inzwischen das zentrale Thema im peruanischen Wahlkampf. Einige Präsidentschaftskandidat*innen versprechen „Mega-Gefängnisse“ und diskutieren sogar, Gefangene nach El Salvador zu verlegen. Auch Überwachung durch Drohnen und erweiterte Befugnisse für die Streitkräfte wurden vorgeschlagen.
Keiko Fujimori von der populistischen rechten Partei „Fuerza Popular“ befürwortet offen eine Politik der „mano dura“ – der harten Hand. Diese Rhetorik ist keineswegs auf Peru beschränkt. Auch in Kolumbien und darüber hinaus werden immer mehr harte Sicherheitsmaßnahmen gefordert.
Von der Demokratiekrise zum Wiederaufleben des Autoritarismus
Peru steht exemplarisch für eine regionale Entwicklung: von demokratischer Dysfunktion hin zu autoritärem Rollback. In den Andenstaaten wächst die Unzufriedenheit mit der Politik – und mit ihr die Forderung nach harten Maßnahmen sowie die Sehnsucht nach starker Führung. In Chile besangen Anhänger*innen des kürzlich gewählten José Antonio Kast offen die Diktatur Augusto Pinochets.
Während Gewalt real ist, ist Sicherheit ohne Legitimität kurzlebig. Die autoritäre Wende und die Forderungen nach harten Maßnahmen lösen die strukturellen Probleme nicht – Ungleichheit, schwache Institutionen und Ausgrenzung bleiben bestehen. Stattdessen entsteht eine gefährliche Allianz zwischen politischen und militärischen Eliten, die es ermöglicht, dass abweichende Meinungen im Namen von Ordnung und Sicherheit gewaltsam unterdrückt werden. In Peru, Ecuador und Kolumbien nimmt die Militarisierung bereits zu.
Wenn Südamerikas Regierungen weiterhin die vermeintlich „aufgeblähten“ staatlichen Institutionen schwächen und im Namen der Sicherheit zunehmend Gewalt anwenden, schaffen sie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Die Staaten werden fragiler, und wie Studien gezeigt haben, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit externer Einflussnahme. Setzt sich diese Entwicklung fort, könnte eine politische Ordnung in die Andenländer zurückkehren, in der in- und ausländische Eliten mit Gewalt regieren, während Forderungen nach Gerechtigkeit unterdrückt werden.
Pedro Alarcón ist Forschungsstipendiat des Global Forum Democracy and Development an der Universität Kapstadt. Er forscht zu Schnittstellen zwischen Klimawandel, Energie und Gesellschaft, besonders in Südafrika, den Andenländern und auf den Philippinen.
pedroalarcon76@gmail.com
Fabio Andrés Díaz Pabón ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politik- und Internationale Studien der Rhodes University. Seine interdisziplinäre Forschung verbindet Wissenschaft und Praxis. Seine Schwerpunkte sind Entwicklung, Nachhaltigkeit und Konflikte in Lateinamerika und Afrika.
fabioandres.diazpabon@uct.ac.za