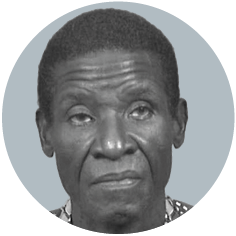Governance
Staatsstreiche in Zeitlupe

Christopher A. Martínez im Interview mit Javier A. Cisterna Figueroa
Ihr Buch handelt vom Scheitern lateinamerikanischer Präsidenten. Was verstehen Sie unter Scheitern?
Damit ist das vorzeitige Ende einer Amtszeit gemeint, also wenn Präsident*innen es nicht schaffen, diese zu Ende zu führen – und zwar nicht aus gesundheitlichen Gründen. In dem Buch versuche ich außerdem, den Fokus auf die politischen Parteien und ihre Bedeutung zu lenken. Ich zeige auf, dass Präsident*innen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ihre Amtszeit normal zu vollenden, wenn es starke Parteien mit Visionen für die Zukunft gibt. Wenn die Parteien aktiv am politischen Leben eines Landes teilnehmen, werden sie es sich zweimal überlegen, eine*n Amtsträger*in abzusetzen. Wenn sie hingegen nur als Vehikel dienen, um ins Parlament zu kommen, herrscht eine kurzfristige Perspektive vor, die zum Scheitern führen kann.
Können schwache Parteien nicht auch dazu führen, dass Präsident*innen unangefochten regieren?
Schwache Parteien können kein politisches Gegengewicht zum Präsident*innenamt bilden, weil ihnen die Organisation fehlt. Da sind lediglich die Abgeordneten, vielleicht auch aus der Opposition, aber nur als Einzelpersonen. Um Präsident*innen zu stürzen, ist aber ein kollektives Vorgehen nötig. Für das Buch habe ich eine Umfrage unter mehr als 300 Sozialwissenschaftler*innen in zwölf Ländern Lateinamerikas durchgeführt. In Guatemala zum Beispiel, wo es praktisch keine politischen Parteien gibt, haben sie auf die Frage nach dem Gegengewicht zum Präsident*innenamt nicht den Kongress genannt, sondern den größten Unternehmensverbund des Landes. An zweiter Stelle nannten sie die sozialen Bewegungen, danach das Militär und die US-Botschaft. Erst an fünfter Stelle wurde der Kongress genannt. Das zeigt: Wenn die Parteien schwach sind, kommt anderen Akteuren die Aufgabe zu, den Einfluss von Präsident*innen zu begrenzen.
Was sind Beispiele in Lateinamerika für starke Parteien und gesunde Demokratien auf der einen Seite und schwache Parteien und Demokratien in der Krise auf der anderen Seite?
Uruguay ist ein klares Beispiel für solide Parteien und eine solide Demokratie. Den Parteien dort gelingt es, die Interessen der Bevölkerung aufzunehmen und in das politische System einzubringen. Ich würde hier auch Chile und Costa Rica nennen, in dieser Reihenfolge. Mexiko ist ein weiteres Land mit relativ starken politischen Parteien, hat aber keine gesunde Demokratie. Beispiele für schwache Parteien und Demokratien in der Krise sind ganz klar Guatemala und Peru. In diesen Ländern sind die Parteien nur Vehikel für die Teilnahme an Wahlen – leere Hüllen mit Menschen, die einfach nur ins Parlament wollen, aber keine Ideen und keine politische Identität haben.
Wo ist heute in Lateinamerika der Autoritarismus besonders stark?
Die kritischsten Fälle, wenn man einmal von Kuba absieht, sind sicherlich Nicaragua, wo Präsident Daniel Ortega zusammen mit seiner Ehefrau und Vizepräsidentin Rosario Murillo praktisch eine diktatorische Dynastie bildet, und natürlich Venezuela unter Nicolás Maduro. Der jüngste Fall ist der von Nayib Bukele in El Salvador, der im Gegensatz zu den zuvor Genannten große Popularität genießt.
Also scheitern Präsident*innen nicht nur, wenn sie abgesetzt werden, sondern Präsidentschaften – und das System – scheitern auch, wenn sie sich in autoritäre Regime verwandeln?
Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem 20. Jahrhundert und dem aktuellen. Im 20. Jahrhundert stand das Militär hinter diesen autoritären Regierungen und führte Putsche durch. Was wir in diesem Jahrhundert sehen, sind Staatsstreiche in Zeitlupe, die mit Präsident*innen anfangen, die in freien Wahlen im politischen Wettstreit ins Amt kommen. Aber sobald sie an der Macht sind, schwächen sie die demokratischen Institutionen und Systeme der Gegengewichte, wie die freie Presse. Zu den Lieblingsmaßnahmen dieser Art von Präsident*innen gehört die Abschaffung der Begrenzung der Amtszeiten durch die Verfassung. Das haben wir in Nicaragua und El Salvador erlebt.
Welche Rolle spielt bei alledem die Wirtschaft? In Zeiten des lateinamerikanischen Rohstoffbooms sprach man in Ländern wie Ecuador, Bolivien oder Venezuela nur wenig vom demokratischen oder institutionellen Niedergang.
Verschiedene politikwissenschaftliche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass zufriedene Bürger*innen nicht sehr gut für die Demokratie sind, weil sie unkritisch werden. Im Falle des Rohstoffbooms profitierten die Menschen von den wirtschaftlichen Erträgen und standen dem Zustand der Demokratie in ihren jeweiligen Ländern relativ unkritisch gegenüber – obwohl das, was in Ländern wie Ecuador, Bolivien und Venezuela passierte, eine offensichtliche Machtkonzentration darstellte. Die Demokratie wurde geschwächt, doch viele Menschen waren bereit, wegzusehen, gerade wegen der guten wirtschaftlichen Bedingungen in der Region.
Was stellt Ihrer Meinung nach aktuell die größte Gefahr für die Demokratie in Lateinamerika dar?
Zweifellos das organisierte Verbrechen. Es hat bewiesen, dass es die historische Schwäche Lateinamerikas und seiner Institutionen für sich zu nutzen weiß. Gleichzeitig erleben wir den Niedergang traditioneller politischer Akteure, wie der politischen Parteien und der Gewerkschaften, und bewegen uns auf eine stark fragmentierte Welt zu, in der unser Weltbild auf Social Media beruht, nicht auf gemeinschaftlichen Projekten. Was wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, wird definitiv nicht noch einmal passieren.
Buch
Martínez, C. A., 2024: Why Presidents Fail. Stanford University Press.
Christopher A. Martínez lehrt Politikwissenschaften an der Universität San Sebastián in Concepción, Chile, und ist stellvertretender Direktor des Millennium Nucleus on Political Crisis in Latin America (CRISPOL).
Javier A. Cisterna Figueroa ist ein chilenischer Journalist und lebt in Concepción.
cisternafigueroa@gmail.com