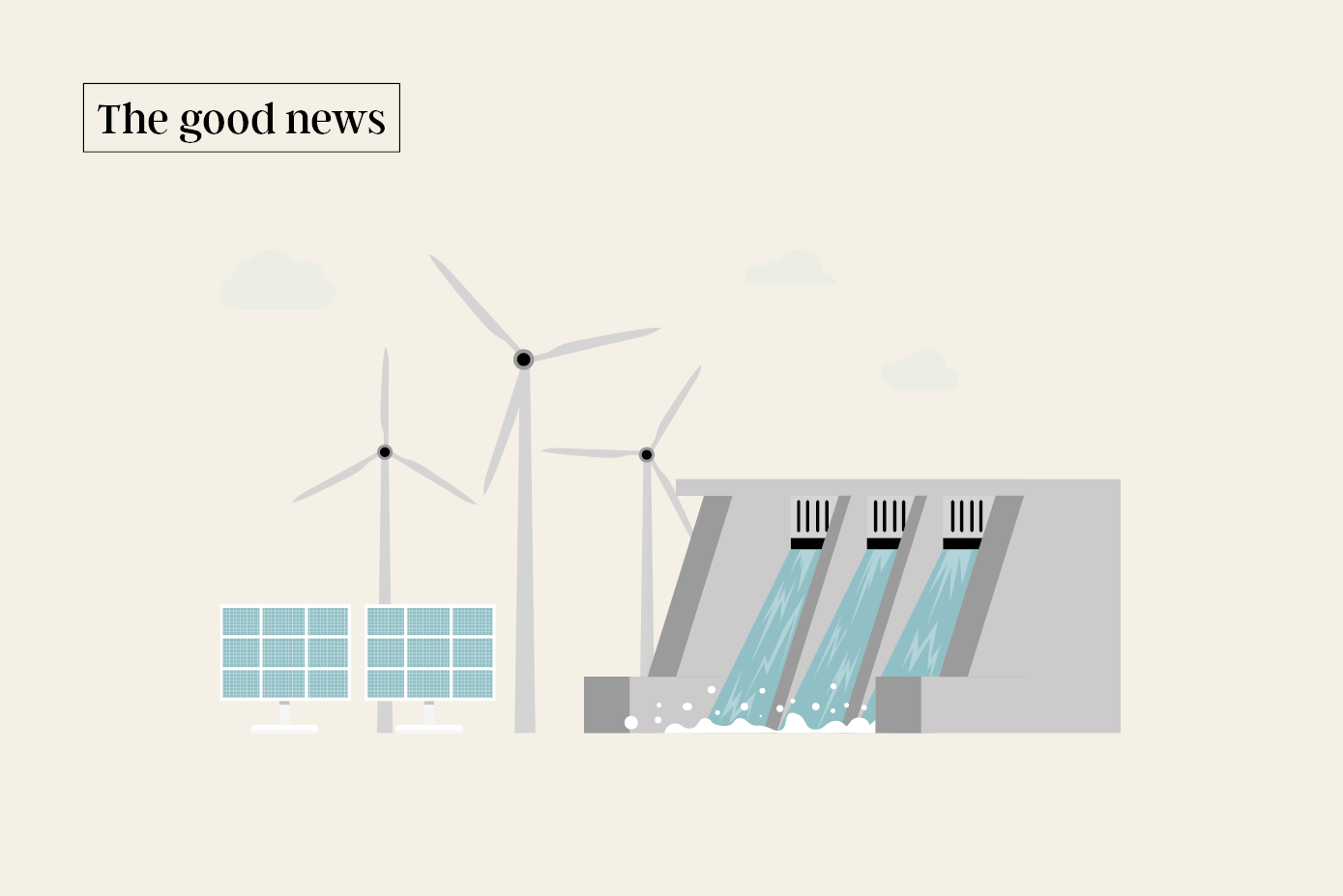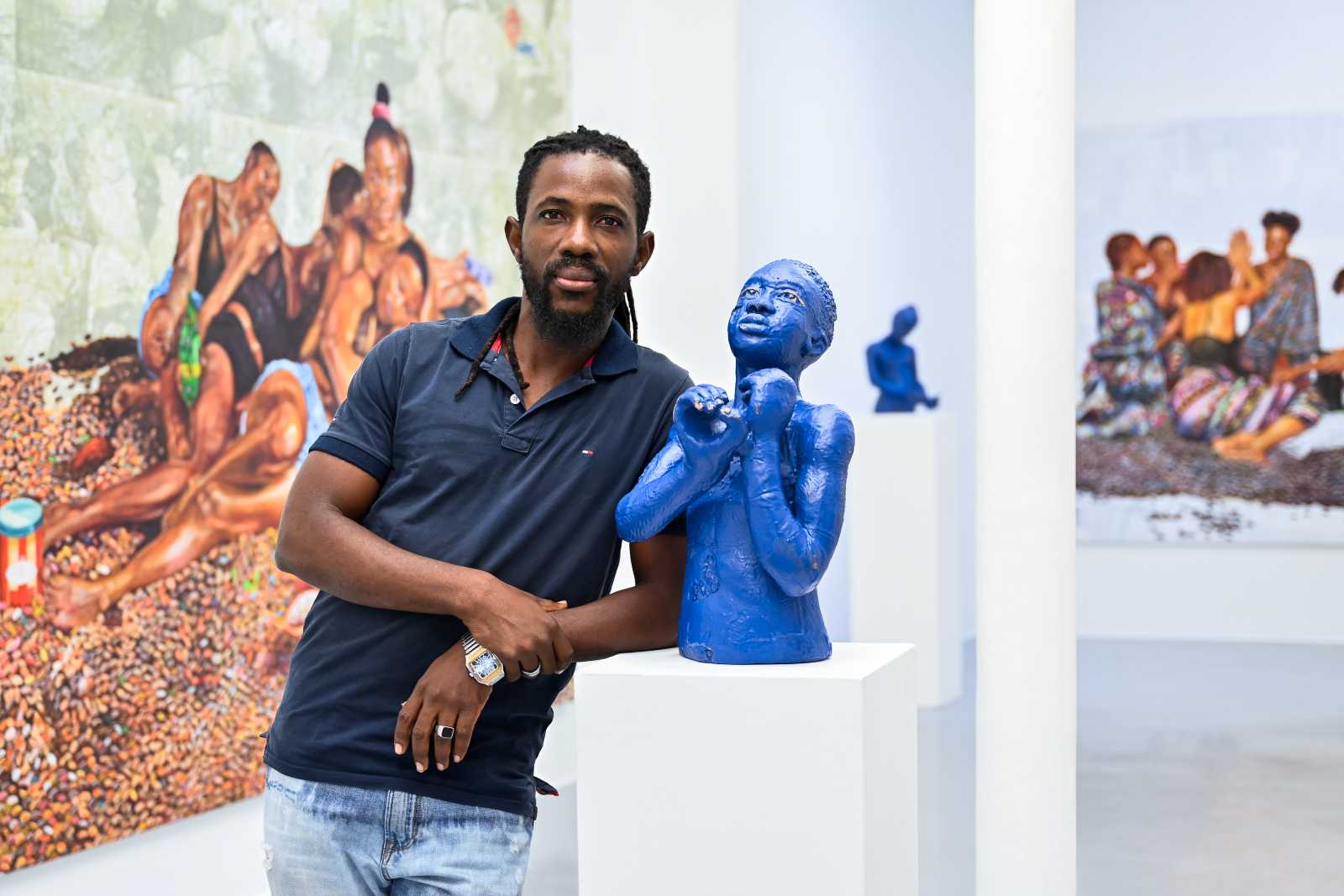Contribution-Claim-Ansatz
Wie Unternehmen freiwillig zu globaler Klimagerechtigkeit beitragen können

Die Anteile am Klimawandel sind auf der Welt ungleich verteilt. Während der Globale Norden die meisten klimarelevanten Emissionen verursacht hat, leidet der Globale Süden besonders unter den Folgen. Diese Klimaschuld des Nordens geht einher mit einer ungleichen Kapitalanhäufung: Im Norden konzentrierte sich im Zuge industrieller Expansion Wohlstand, während viele Länder des Südens ökonomisch abhängig blieben.
Klimagerechtigkeit herzustellen bedeutet daher nicht nur, historische Verantwortung anzuerkennen, sondern auch koloniale Kontinuitäten und ungleiche Wohlstandsverhältnisse abzubauen. Zwar ist das Ziel insbesondere aus Sicht vieler Vertreter*innen des Globalen Südens noch in weiter Ferne, immerhin aber haben sich die meisten Länder im Rahmen des Pariser Abkommens von 2015 verpflichtet, ihre national festgelegten Klimabeiträge (Nationally Determined Contributions – NDCs) kontinuierlich zu erhöhen.
In die Berechnung fließen auch die Maßnahmen nichtstaatlicher Akteure ein. Neben dem Handel mit Emissionszertifikaten, der in der EU etwa für große, energieintensive Industrieanlagen verpflichtend ist, verringern auch viele Unternehmen ihre Emissionen freiwillig. Insbesondere dort, wo dies nur schwer möglich ist, greifen sie zudem auf Ausgleichszahlungen zurück, etwa um klimafreundliche Projekte im Globalen Süden zu finanzieren. Die so finanzierten Emissionsreduktionen fließen dabei jedoch oft in die Bilanz der jeweiligen Unternehmen ein, verbleiben also im Globalen Norden. Wenn Unternehmen Emissionen durch Zahlungen kompensieren, anstatt sie direkt selbst einzusparen, obgleich Letzteres gut möglich wäre, sehen sie sich zudem bisweilen mit dem Vorwurf des Greenwashings konfrontiert.
Klimaschutz außerhalb der Wertschöpfungskette fördern
Der Contribution-Claim-Ansatz ist ein alternatives Modell zur CO2-Kompensation, mit dem Unternehmen des Globalen Nordens den globalen Klimaschutz außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette fördern können. Auch hier kommen sie mit einem finanziellen Beitrag für ihre eigenen Emissionen auf. Der wesentliche Unterschied: Die Unternehmen setzen den Preis für die von ihnen ausgestoßenen Emissionen selbst fest, berichten ihn transparent und lassen sich die Reduktionen nicht auf ihre eigene Klimabilanz anrechnen. Dies hat zur Folge, dass die Reduktionen den Ländern angerechnet werden können, in denen die Projekte zur Emissionseinsparung stattfinden. Es profitieren also Länder des Globalen Südens.
Zu den Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen im Rahmen des Contribution-Claim-Modells zählen die folgenden drei Optionen (Kreibich et al. 2024):
- Unternehmen können CO2-Zertifikate von Klimaschutzprojekten des freiwilligen Kohlenstoffmarkts kaufen. So stellen sie die Durchführung der Projekte sicher.
- Sie können in einen Fonds einzahlen, der als Fördertopf für Klimaschutzmaßnahmen dient und keine Rendite an die Unternehmen auszahlt.
- Sie können eigene Klimaschutzmaßnahmen und -projekte direkt finanzieren. Diese Projekte müssten intern und gegebenenfalls auch extern überprüft werden.
Die Finanzierungsoptionen können jeweils einzeln oder in Kombination genutzt werden.
Vorteile des Contribution-Claim-Modells
Da der Contribution-Claim-Ansatz die Unterstützung der Unternehmen von deren Emissionsbilanz trennt, werden Doppelzählungen und Greenwashing-Strategien verhindert. Dies bedeutet für die Unternehmen eine rechtliche Absicherung und stärkt zudem das Vertrauen der Kundschaft in die Emissionsminderungen. Letzteres gilt insbesondere dann, wenn die Mittel in wissenschaftlich fundierte, hochwertige Projekte zur Emissionsminderung fließen und wenn die Unternehmen den von ihnen selbst festgesetzten Preis transparent kommunizieren und begründen.
Unternehmen, die den Contribution-Claim-Ansatz verfolgen, zahlen damit zwar nicht auf ihre eigene Klimabilanz ein, können aber für sich beanspruchen, zur globalen Klimaneutralität beizutragen, indem sie helfen, Emissionen im Globalen Süden einzusparen und die Einsparungen den Bilanzen dieser Länder zugutekommen zu lassen. Somit leisten sie einen Beitrag zu globaler Klimagerechtigkeit – ein sinnstiftendes Moment, das sich positiv auf die Mitarbeitendenbindung und das Image der Unternehmen auswirken kann.
Die gemeinnützige Klima-Kollekte und zivilgesellschaftliche Organisationen wie Brot für die Welt setzen den Contribution-Claim-Ansatz bereits um. Unternehmen können über sie Klimaschutzprojekte finanzieren, die extern überprüft sowohl Emissionen reduzieren als auch soziale und wirtschaftliche Entwicklung fördern. Diese Projekte verbessern die Lebensbedingungen vor Ort mit relativ geringen Mitteln teils erheblich, wie ein Beispiel aus dem Süden Ruandas zeigt. Dort werden ländliche Gemeinschaften mit energieeffizienten Kochherden ausgerüstet. Dies reduziert sowohl CO2-Emissionen als auch die gesundheitliche Belastung durch schädliche Gase. Es wirkt der Abholzung entgegen, schafft Arbeitsplätze und erspart den Menschen vor Ort auch Zeit, die sie sonst auf der Suche nach Brennholz verbringen müssten.
Lukas Küsters arbeitete bis Juni 2025 als Referent für CO2-Bilanzierung und Beratung bei der Klima-Kollekte.
lukaskuesters@gmx.de
Kirsten Gade ist bei Brot für die Welt die Ansprechpartnerin für die Finanzierung von zertifizierten Klimaschutzprogrammen zur Förderung von Klimagerechtigkeit.
kirsten.gade@brot-fuer-die-welt.de