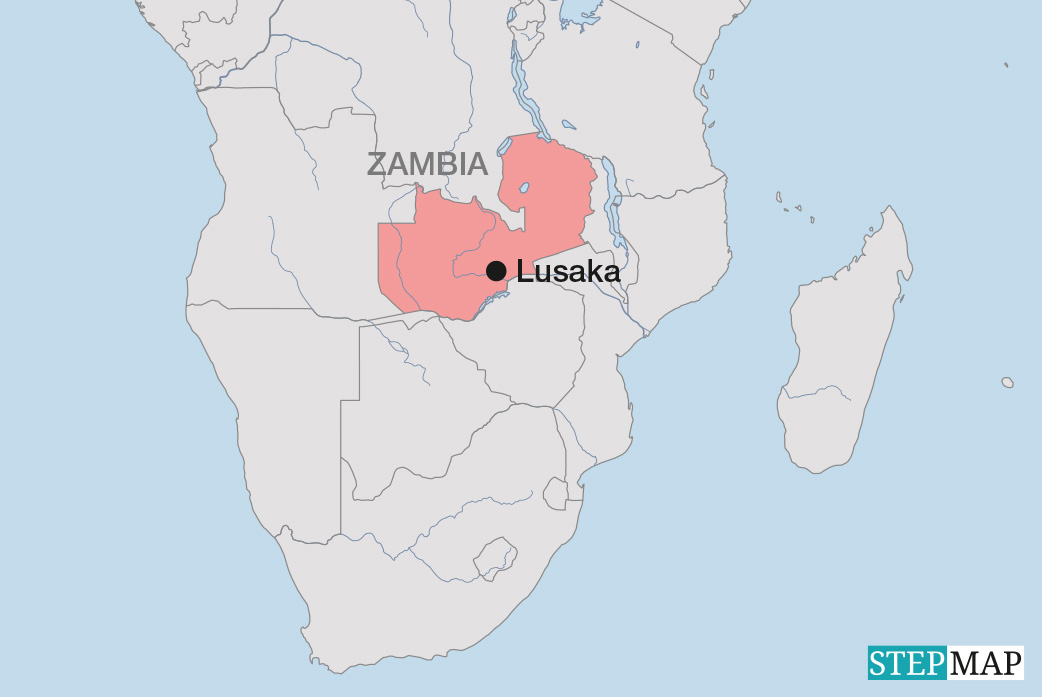Impact Investing
Wie man reiche Menschen davon überzeugt, ihr Geld sinnvoll auszugeben

Der dramatische Anstieg globaler Ungleichheit ist keine Neuigkeit. Als Forbes 1987 begann, Milliardär*innen zu erfassen, gab es 140. Heute sind es 3028 – darunter 247 Neuzugänge allein im letzten Jahr. Das Gesamtvermögen dieser Personen liegt bei 16,1 Billionen Dollar. Die reichsten 1,5 % der Menschen besitzen heute 48 % des globalen Vermögens.
In der Geschichte der Menschheit haben noch nie so wenige Leute so viel besessen. Ihr Vermögen wäre mehr als ausreichend, um einen transformativen globalen Wandel zu finanzieren – von der Bekämpfung des Klimawandels bis zur Abschaffung von Hunger und extremer Armut –, während sie weiterhin extrem reich blieben. Doch statt mehr wird weniger in Nachhaltigkeit investiert. Im vergangenen Jahr zogen Investierende fast 20 Milliarden Dollar aus nachhaltigen Fonds mit Sitz in den USA ab. Fundraising für ökologische und soziale Zwecke bleibt weiterhin zäh.
Es bleibt die Frage, warum die Finanzelite ihre immensen Ressourcen nicht nutzt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was hält die Reichsten davon ab, sich um ein positives Vermächtnis zu bemühen, statt mehr Reichtum anzuhäufen?
Nachhaltige Entwicklung ist nur möglich, wenn Impact Investing deutlich bekannter wird. Die Menschheit steht vor derart herausfordernden Aufgaben, dass Regierungen und NGOs sie nicht allein bewältigen können. Der Privatsektor muss skalierbare Lösungen finanzieren, die Rentabilität mit sozialer und ökologischer Verantwortung verbinden.
Das ist die Kernidee hinter Impact Investing: Kapital in Unternehmen zu lenken, die finanzielle Renditen und messbare Vorteile für Mensch und Erde erzielen. Unternehmen wie Goodwell Investments, bei dem ich arbeite, investieren etwa in afrikanische Unternehmen in der Frühphase, die unterversorgte Bevölkerungsgruppen mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen versorgen.
Hindernisse für Impact Investing
Impact Investing scheint eine Win-win-Situation zu sein: Es ist sowohl verantwortungsvoll als auch profitabel und fördert Nachhaltigkeit und soziale Inklusion. Dennoch zögern viele reiche Menschen, sich darauf einzulassen. Der Grund dafür liegt in einer Mischung aus strukturellen und psychologischen Hürden.
Die Psychologie des Reichtums ist äußerst komplex. Geld steht für Freiheit, Chancen und Sicherheit. Diese Freiheiten für sich selbst und künftige Generationen zu bewahren, ist ein tief verwurzelter menschlicher Instinkt. Mit dem Vermögen wächst somit auch der Wunsch, es zu schützen. Viele vermögende Privatpersonen konzentrieren sich daher eher darauf, ihr Vermögen zu sichern, als es für soziale oder ökologische Zwecke einzusetzen.
Reichen Investierenden stehen zudem oft die eigenen Vermögensverwaltungen im Weg, die als Torwächter des Kapitals fungieren. Selbst wenn die Kundschaft Interesse hat, schlagen Beratende selten Impact-Investment-Optionen vor. Tatsächlich sind es oft die Anleger*innen selbst, die ihre Vermögensverwaltungen auf solche Optionen hinweisen – nicht umgekehrt.
Finanzberater*innen neigen dazu, Risiken zu betonen und die Kundschaft zu konventionellen Portfolios mit geringer Volatilität zu lenken. Dies verstärkt die Herdenmentalität, für die Finanzmärkte bekannt sind. Obwohl einige Befürwortende von Impact Investments innerhalb von Finanzinstituten daran arbeiten, diese Denkweise zu ändern, sind sie nach wie vor eher die Ausnahme.
Impact Investing erfordert auch ein bestimmtes Mindset, geprägt davon, wie Investierende ihre Vermögen aufgebaut haben. Sehen sie sich selbst als Unternehmende? Welche sozialen oder ökologischen Themen liegen ihnen am Herzen? Welches Vermächtnis möchten sie hinterlassen? Für reiche Menschen kann die Auseinandersetzung mit solchen Fragen die Grundlage für eine gesamte Anlagestrategie bilden.
Wirkungsorientiert zu denken bedeutet auch, Privilegien anzuerkennen – etwa die Fähigkeit, begrenzte Liquidität und längere Anlagehorizonte in Kauf zu nehmen, im Gegenzug für bedeutende soziale und ökologische Renditen.
Hindernisse für Impact Investing in Afrika
Diese allgemeinen Hindernisse sind nur erste Hürden in einem weitaus längeren Rennen. Neue Impact-Investierende bleiben oft in ihrer Komfortzone und bevorzugen geringes Risiko gegenüber messbarer Wirkung. Oft gelten erneuerbare Energien oder digitale Technologien als „sichere“ Sektoren.
Beim Impact Investing in Afrika zeigen sich diese Hürden noch deutlicher. Investitionen in den Kontinent sehen wirkungsorientierte Investierende immer noch erst als zweiten oder gar dritten Schritt – etwas, das später zu überlegen ist, wenn überhaupt. Investierende ohne private oder berufliche Verbindungen zum Kontinent schrecken davor oft zurück. Dadurch verpassen sie echte Chancen sowohl auf finanzielle Erträge als auch auf transformative soziale Wirkung.
Das Fehlen persönlicher Beziehungen ist eine echte Herausforderung. Afrikanische Anleger*innen erhöhen nach und nach ihre Investitionen auf dem Kontinent. Im vergangenen Jahr gab die African Private Capital Association an, dass 31 % der aktiven Risikokapitalinvestitionen von Afrikaner*innen getätigt wurden – die damit als größte Einzelinvestorengruppe des Kontinents auftreten. Für viele internationale Anleger*innen scheint Afrika jedoch weit weg. Oft fehlen ihnen zuverlässige Informationen über Anlagemöglichkeiten – besonders wenn ihre Finanzberatungen diese nicht bereitstellen. Hartnäckig halten sich veraltete Vorstellungen und verschleiern die unternehmerische Dynamik, die boomende Tech-Szene, das schnelle Bevölkerungswachstum und das enorme Geschäftspotenzial, das Afrika bietet.
Das ist ein Grund, warum es besonders sinnvoll ist, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die wichtige Güter und Dienstleistungen anbieten. Solche Investitionen haben vor Ort spürbare soziale Auswirkungen und bieten Anleger*innen gleichzeitig zugängliche und widerstandsfähige Möglichkeiten – Unternehmungen, die Krisen überstehen und dennoch nachhaltige Renditen erzielen können.
Umdenken anregen
Finanzielle und soziale Renditen können helfen, die Wahrnehmung der Investierenden zu verändern – weg davon, Impact Investments als wohltätige Spenden zu sehen, und hin dazu, sie als sinnvolle, langfristige Kapitalbindungen zu erkennen. Sie zu diesem ersten Schritt zu bewegen, ist allerdings das Schwierigste.
Beziehungen zu wirkungsorientierten Anleger*innen aufzubauen, ist das A und O. Das können Menschen mit persönlichen Verbindungen zu einer bestimmten Region oder Branche sein oder solche, die sich für bestimmte soziale oder ökologische Themen interessieren. Vertrauen und ein gemeinsames Ziel sind unabdingbar – ohne diese wagen sich reiche Investierende kaum auf unbekanntes Terrain.
Fondsmanager*innen haben auch eine erzieherische Rolle. Sie müssen klarstellen, dass Impact Investing nicht Philanthropie, sondern Investition ist – mit finanzieller Disziplin, messbaren Ergebnissen und klarem Fokus auf Gewinn und Zweck. Von da an sollte der Schwerpunkt vom wahrgenommenen Risiko auf die nachgewiesenen Auswirkungen verlagert werden. Das ist zentral, um vermögende Anleger*innen zu überzeugen, ihr Kapital dort einzusetzen, wo es wirklich etwas bewirken kann.
Im nächsten Schritt muss Investieren leichter gemacht werden. Mechanismen wie Co-Investment-Modelle, Garantien und gemischte Finanzierungsstrukturen können helfen, das wahrgenommene Risiko zu senken, sodass sich die erste Investition weniger wie ein Sprung ins Ungewisse anfühlt. Teil dieses „Mindset-Toolkits“ sollten Instrumente wie First-Loss-Kapital, ergebnisorientierte Finanzierung, Umsatzbeteiligungsmodelle und Garantien von Entwicklungsfinanzierungsinstituten sein.
Auch die direkte Erfahrung ist wichtig. Über ein vielversprechendes Projekt in Nigeria oder Uganda zu lesen, ist etwas anderes, als Unternehmende persönlich zu treffen und die positiven Auswirkungen ihrer Arbeit zu sehen. Durch Besuche vor Ort können aus abstrakten Ideen greifbare Überzeugungen werden.
Investierenden muss Afrika als Kontinent der Chancen, nicht der Wohltätigkeit, präsentiert werden – etwa über konkrete Daten und Erfolgsgeschichten, bei denen Investitionen messbare Auswirkungen und zugleich wettbewerbsfähige finanzielle Renditen erzielt haben. Die veraltete Erzählung von der „Hilfe für die Armen“ muss einer neuen Erzählung von der „Partnerschaft mit Innovator*innen“ weichen.
Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit gibt es viele Gründe, optimistisch in die Zukunft des Impact Investing zu blicken. Laut PwC waren im Jahr 2024 sogenannte „Family Offices“ für 54 % des weltweiten Impact-Investing-Volumens verantwortlich. Ein Family Office ist ein Unternehmen, das das Privatvermögen einer einzelnen Familie verwaltet. In den USA verfolgen immer mehr dieser Unternehmen einen reinen Impact-Ansatz. Zunehmend übernehmen Millennials und jüngere Generationen Verantwortung für die Vermögensverwaltung, deren Anlageprioritäten stärker von sozialen und ökologischen Überlegungen geprägt sind. Sind sie einmal überzeugt, bringen sie oft ältere Generationen dazu, ihrem Beispiel zu folgen. Generell gilt: Ist die erste Investition erfolgreich, wächst das Vertrauen. Positive finanzielle und soziale Ergebnisse können reiche Menschen zu aktiven Fürsprechenden machen, die andere aus ihrer Gruppe dazu ermutigen, ebenfalls Gutes zu tun und dabei erfolgreich zu sein.
Nico Blaauw ist Partner bei Goodwell Investments und verantwortlich für die Bereiche „Investor Relations and Marketing“ sowie „Communication and Communities“.
contact@goodwell.nl