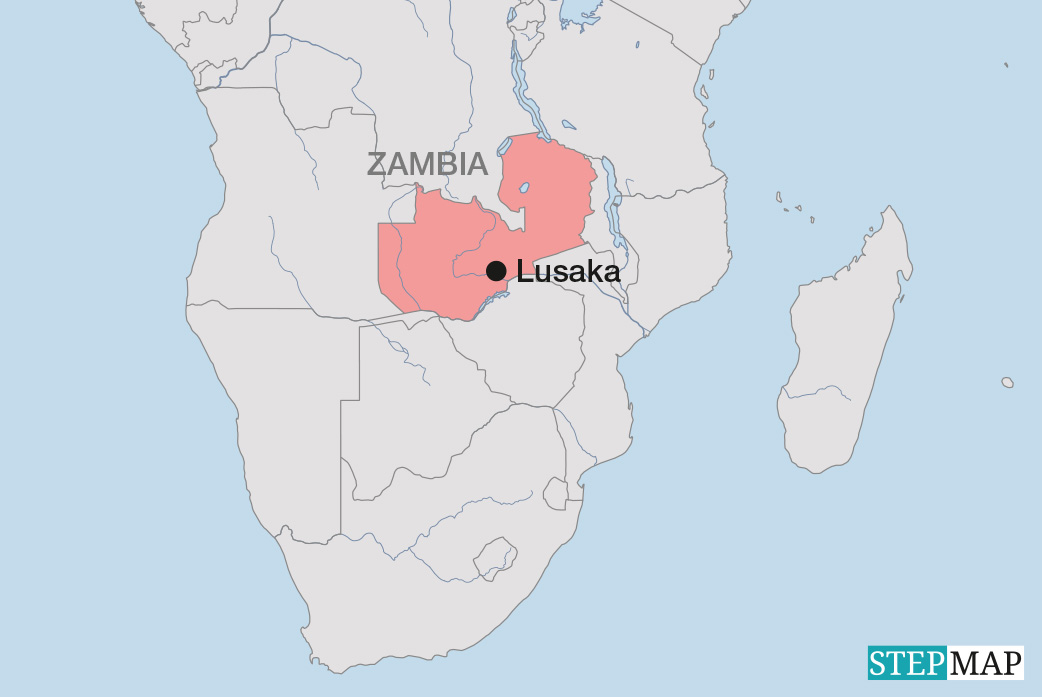Weltklimakonferenz
Die Milliardenlücke

Zehn Jahre nach dem Klimaschutzabkommen von Paris ist die Stimmung bei Klimaschützer*innen gedrückt. Auf der Konferenz von Baku im vergangenen Jahr einigten sich die teilnehmenden Staaten auf das ambitionierte Ziel, ab 2035 jährlich 1,3 Billionen Dollar für Klimaschutz und -anpassung in Entwicklungs- und Schwellenländern bereitzustellen. 300 Milliarden Dollar davon sollen aus den Industrieländern kommen. Doch nicht erst seit der erneuten Ankündigung der USA, ab Januar 2026 aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten, ist fraglich, woher das Geld kommen soll. Schon das frühere Ziel von 100 Milliarden Dollar jährlich bis 2020 wurde mehrfach verschoben. Kaum jemand glaubt deshalb an eine Trendwende in der Klimafinanzierung.
Solange die Finanzierungsfrage offen ist, können viele Länder auch ihre nationalen Klimaziele nicht komplett umsetzen. In den „Nationally Determined Contributions“ (NDCs) legen die Vertragsstaaten regelmäßig ihre Klimaschutzziele dar und kommunizieren die dafür vorgesehenen Maßnahmen. Die Frist für die diesjährigen NDCs war der 10. Februar 2025. Am 30. September hatten erst 64 der 194 Vertragsstaaten ihre NDCs eingereicht.
„Moderner Ablasshandel“
Die EU veröffentlichte ihre NDCs nach schwierigen internen Verhandlungen am 5. November 2025 – fünf Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz. Der Europaabgeordnete Michael Bloss sieht deren Inhalte kritisch. Insbesondere die neuen Bestimmungen zum CO2-Zertifikatehandel seien ein „moderner Ablasshandel“ und eine „Mogelpackung“, so das Mitglied der Europafraktion der Grünen auf einer Pressekonferenz der Heinrich-Böll-Stiftung. Bis zu fünf Prozent der europäischen CO2-Einsparungen sollen ab 2031 in Form von Klimagutschriften in Drittstaaten angerechnet werden können. Ein System, das sich in der Vergangenheit als anfällig für Korruption und Betrug erwiesen habe, so der Abgeordnete.
Hinter der Debatte um den CO2-Zertifikatehandel steht auch eine finanzielle Überlegung: Europa sucht nach kostengünstigen Wegen, seine Klimaziele zu erreichen. Bloss befürchtet, dass Europa seine Glaubwürdigkeit und damit seine Vorreiterrolle in der internationalen Klimapolitik verlieren werde.
Rolle Chinas
Diese Position könnte etwa von China übernommen werden. Das Image der Volksrepublik in Ländern des Globalen Südens sei gut, so Regine Schönenberg, die für die Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro arbeitet. Angesichts des Rückzugs der USA aus dem multilateralen System zur Bekämpfung des Klimawandels sprächen einige Beobachter*innen bereits von einem „Multilateralismus des Globalen Südens“ – mit China an der Spitze.
Die Finanzierungsfrage bliebe aber auch in einem solchen „Multilateralismus des Globalen Südens“ offen. China beharrt auf seinem Status als „Schwellenland“ und gibt keine verbindlichen Finanzierungszusagen ab. Darin gleicht es anderen aufstrebenden Ländern, die für ihre wirtschaftliche Entwicklung teils weiterhin stark auf fossile Brennstoffe setzen. Nicht nur sie verweisen auf die historische Verantwortung der Staaten des Globalen Nordens. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz von Klima-Allianz Deutschland, VENRO und der brasilianischen NGO-Allianz ABONG spricht Henrique Froda von ABONG vom Prinzip der „gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung“. Damit meint er, dass die europäischen und nordamerikanischen Staaten historisch gesehen einen erheblichen Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen hatten. Auch wenn ihr Beitrag heute geringer ausfällt, trügen sie deshalb eine besondere finanzielle Verantwortung.
In der Praxis führe dieses Argument aber zu einer Blockade, so Froda weiter. Denn die Taschen der Europäer*innen sind nicht mehr so tief wie einst. Viele Staaten erhöhen ihr Verteidigungsbudget, so manche Volkswirtschaft schwächelt, und im Zuge des gesellschaftlichen „Vibeshift“ in der westlichen Welt verändert sich die öffentliche Debatte. Der politische Spielraum für zusätzliche Ausgaben droht zu schwinden.
Deshalb betont die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, es sei nicht die Aufgabe der Politik, den schwankenden Stimmungen einer aufgeheizten Debatte hinterherzulaufen. Sie müsse aktiv Mehrheiten für ein sinnvolles Klimaschutzprogramm organisieren. Dabei dürfe man auch nicht vergessen, wie viel schon erreicht worden sei, so Neubauer. 2015 steuerte die Welt auf ein 4-Grad-Szenario zu. Jetzt – zehn Jahre nach dem Pariser Abkommen – hat die UN die voraussichtliche Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad beziffert. Das ist ein Erfolg. Trotzdem fasst Neubauer die allgemeine Stimmung zusammen, wenn sie sagt: „Die COP ist nicht der Ort, wo die Klimakrise gelöst wird. Aber es ist immer noch das legitimste Forum, um gemeinsam dafür zu kämpfen.“
Alle Zitate in diesem Text stammen von Teilnehmer*innen einer Pressekonferenz der Heinrich-Böll-Stiftung sowie einer gemeinsamen Pressekonferenz von Klima-Allianz Deutschland, VENRO und der brasilianischen NGO-Allianz ABONG. Beide Pressekonferenzen fanden im Vorfeld der COP30 Anfang November 2025 statt.
Björn Cremer ist Volontär bei Engagement Global.
bjoern.cremer@engagement-global.de
Dieser Beitrag ist Teil des „89 Percent Project“, einer Initiative der globalen Journalismus-Kooperation „Covering Climate Now“.