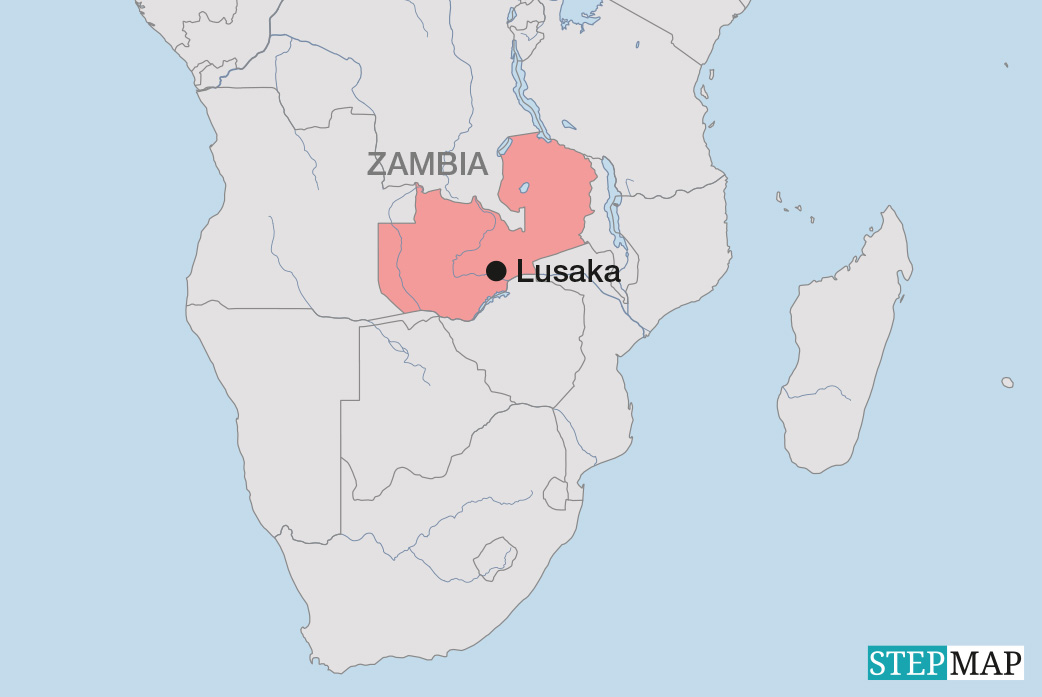Vertreibung durch Konflikt
„Ich wollte in Bergkarabach sterben“

Irina Baghdasaryan hat alles verloren. Zwei Jahre ist es nun her, dass die Armenierin aus ihrer Heimat Bergkarabach vertrieben wurde. Die 38-Jährige erinnert sich mit Schrecken an jenen 19. September 2023. Sie lebte mit ihrer Familie im Dorf Chankatagh in der Region Martakert. Am Vormittag jenes Dienstags hörte sie vom Einmarsch aserbaidschanischer Truppen. Es ging alles so schnell, dass sie nicht einmal mehr ein Familienfoto von der Wand nehmen konnte. Die Familie floh mit vier kleinen Kindern und der damals 81 Jahre alten Großmutter Raya, als ihr Dorf schon vom aserbaidschanischen Militär umstellt war.
Irgendwie fanden sie einen Durchschlupf und schlugen sich in die Wälder, liefen die ganze Nacht, zeitweise verfolgt von Soldaten. Sie hatten kein Essen dabei, kein Wasser und an Kleidung nur das, was sie am Leibe trugen. Auf der Flucht sahen sie, wie ein armenischer Panzer vor ihren Augen durch eine Granate zerstört wurde. Endlich trafen sie auf armenische Soldaten, die sie auf einem Lastwagen in die Hauptstadt Bergkarabachs, Stepanakert, mitnahmen. Dort harrten sie noch vier Tage bei Bekannten aus, bis sie in einem mit Flüchtlingen überfüllten Bus über den Latschin-Korridor, der einzigen Landverbindung zwischen dem auf aserbaidschanischem Territorium gelegenen Bergkarabach und Armenien, ins armenische Kernland gelangten.
Die Baghdasaryans teilen ihr Schicksal mit rund hunderttausend Landsleuten. Mit der Eroberung Bergkarabachs endete eine mehrtausendjährige armenische Besiedlung der Region. Das muslimische Aserbaidschan besetzte die christliche armenische Exklave und vertrieb alle dort lebenden Armenier*innen. Die seit Jahrzehnten immer wieder aufflammenden kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Nachbarstaaten waren damit beendet. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken hatten seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre mehrere Kriege gegeneinander geführt. Anfangs siegte Armenien und eroberte ein großes Gebiet rund um Bergkarabach; später holte sich Aserbaidschan diese Territorien zurück und schuf mit der Vertreibung der Armenier*innen aus Bergkarabach ganz neue Tatsachen.
Bergkarabach ist heute weitgehend verwaist. Aserbaidschanische Soldatenfamilien seien dort angesiedelt worden, heißt es. Im August 2025 unterzeichneten die Regierungen in Jerewan und Baku ein Abkommen, in dem beide Länder versprechen, die territoriale Integrität in den geltenden Grenzen anzuerkennen.
Unterstützung aus der Zivilgesellschaft
In Armenien aufgenommen wurde die Familie Baghdasaryan von der zivilgesellschaftlichen Organisation Syunik-Development in Yeghegnadzor, der Hauptstadt der Provinz Wajoz Dsor im Süden des Landes. Aufgabe von Syunik-Development ist es nach eigener Darstellung, die Landbevölkerung bei der Lösung aktueller sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und bildungsbezogener Probleme zu unterstützen.
Die Initiative dazu kam 1995 vom Bistum der armenisch-apostolischen Kirche in der Region, genauer von Erzbischof Abraham Mkrtchyan, Gründer der Organisation und heute ihr Vorsitzender. Es war die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als der gerade unabhängig gewordene armenische Staat sich erst neu finden musste und vieles in der Hauptstadt Jerewan passierte, aber wenig auf dem Land.
Das Stadt-Land-Gefälle ist bis heute eines der größten Strukturprobleme Armeniens. Alles konzentriert sich auf Jerewan. Das Wirtschaftswachstum dort hat sich vom Rest des Landes abgekoppelt, das Preisniveau entspricht dem westeuropäischer Metropolen. Die Provinz hingegen leidet unter Unterbeschäftigung und niedrigen Einkommen.
Von Nothilfe bis Bildungsprogramme
„Eine unserer wichtigsten Aufgaben war 2023 die Nothilfe für Flüchtlinge“, sagt Projektkoordinatorin Hayarpi Aghakhanyan. „Es ging dabei um die Versorgung mit grundlegenden Gütern wie Nahrung, Kleidung, medizinischer Versorgung. In einem zweiten Schritt bauen wir dann nachhaltige Unterstützung in Form von Wohnungen, Bildungsprogrammen, Jugendarbeit und unterstützender Sozialarbeit auf.“
Auch die Familie Baghdasaryan kam in den Genuss dieser Hilfen. Nach der ersten Zeit in einer Flüchtlingsunterkunft fand sie mit Hilfe von Syunik-Development eine Wohnung in Yeghegnadzor. Dort lebt die Familie noch heute unter ärmlichen Verhältnissen. Irina Baghdasaryan, die in Bergkarabach als Assistentin der Geschäftsführung einer Goldmine gearbeitet hatte, ist trotz aller Hilfen nach der Flucht und trotz großer Solidarität ihrer neuen Nachbarn nie richtig in der Gesellschaft des Kernlandes angekommen. Sie ist geschieden und arbeitslos. Der zehnjährige Sohn Artur ist seit der Flucht traumatisiert und bedarf viel Zuwendung durch die Mutter, die deshalb nicht arbeiten gehen kann.
Angewiesen ist die Familie auf die karge Rente der heute 83 Jahre alten Großmutter Raya, die in Bergkarabach als Reinigungskraft gearbeitet hat. Die schwarz gekleidete, ausgemergelte alte Dame verbirgt ihr Gesicht in den Händen; ihr laufen Tränen über die Wangen, als sie von der Flucht berichtet. „Ich wollte in Bergkarabach sterben und dort begraben werden“, sagt sie. „Dann haben wir alles verloren, sogar unser eigenes Grab.“
Ähnlich hart traf es die Familie Ishkhanyan, die heute in einem kleinen Haus am Rande von Yeghegnadzor lebt. Sie wurde sogar zweimal vertrieben: im Krieg 2020 aus ihrer Stadt Schuschi und dann 2023 noch einmal und endgültig aus Stepanakert, wohin sie nach Ende der Kampfhandlungen 2020 gezogen war. Sie haben sich aber im Gegensatz zu den Baghdasaryans eine Perspektive in Armenien aufgebaut. Familienvater Armen Ishkhanyan arbeitet als Fernfahrer, seine Frau Gohar als Designerin. Auch wenn sie sich integriert hätten, gäben sie nie die Hoffnung auf, eines Tages nach Bergkarabach zurückzukehren, sagt Gohar Ishkhanyan. Die armenische Staatsbürgerschaft haben sie jedenfalls nicht angenommen, aus Furcht, sich damit die Rückkehr zu verbauen.
Abhängig von russischem Gas
Auf dem Dach des Hauses steht eine moderne Solarthermieanlage. Die wurde von der NGO Syunik-Development finanziert, sagt Projektkoordinatorin Aghakhanyan. „Damit kann Familie Ishkhanyan im Winter Heizkosten sparen.“ Armenien ist abhängig von russischem Gas und bezieht dieses zwar relativ günstig. Jedoch ist die Kaufkraft eines armenischen Haushalts auf dem Land niedrig, sodass die Kosten für Gas in den langen, kalten und schneereichen Wintern des Südkaukasus deutlich zu Buche schlagen. Die Solarthermieanlage hilft Familie Ishkhanyan daher enorm.
„Wir finanzieren uns durch kirchliche Mittel und durch Unterstützung von internationalen Partnern“, sagt Hayarpi Aghakhanyan von Syunik-Development. Als Beispiel für ausländische Geldgeber nennt sie Brot für die Welt und die Europäische Kommission. Die internationalen Partner sitzen in insgesamt 20 Ländern, die meisten in Westeuropa. Aber auch Georgien und Russland sind darunter – zwei Staaten, zu denen Armenien besondere Beziehungen pflegt. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Finanzmittel kommt aus Spenden der weltweiten armenischen Diaspora. Schätzungsweise 8 bis 10 Millionen Armenier*innen leben im Ausland, während die Einwohnerzahl von Armenien selbst nur etwa 3 Millionen Menschen beträgt. Viele der Auslandsarmenier*innen haben es in Europa, den USA oder Russland zu etwas gebracht. Die Verbindungen zwischen der Diaspora und dem Kernland sind traditionell eng.
Nach dem Ansturm aus Bergkarabach im Herbst 2023 und der Nothilfe für die Geflüchteten hat sich Syunik-Development wieder der mittel- und langfristigen Entwicklung in der Region zugewandt. Landwirtschaftliche Initiativen, Kindergärten, Bildungsarbeit, Förderung von Nachbarschaftshilfen sowie Jugend- und Sozialarbeit stehen in Yeghegnadzor im Zentrum der Arbeit. Ziel sei es, so heißt es auf der Website der Organisation, einen Beitrag zu einer stabilen und demokratischen Gesellschaft in Armenien zu leisten, die auf die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet ist.
André Uzulis ist der Chefredakteur von loyal – Magazin für Sicherheitspolitik.
andre.uzulis@fazit.de