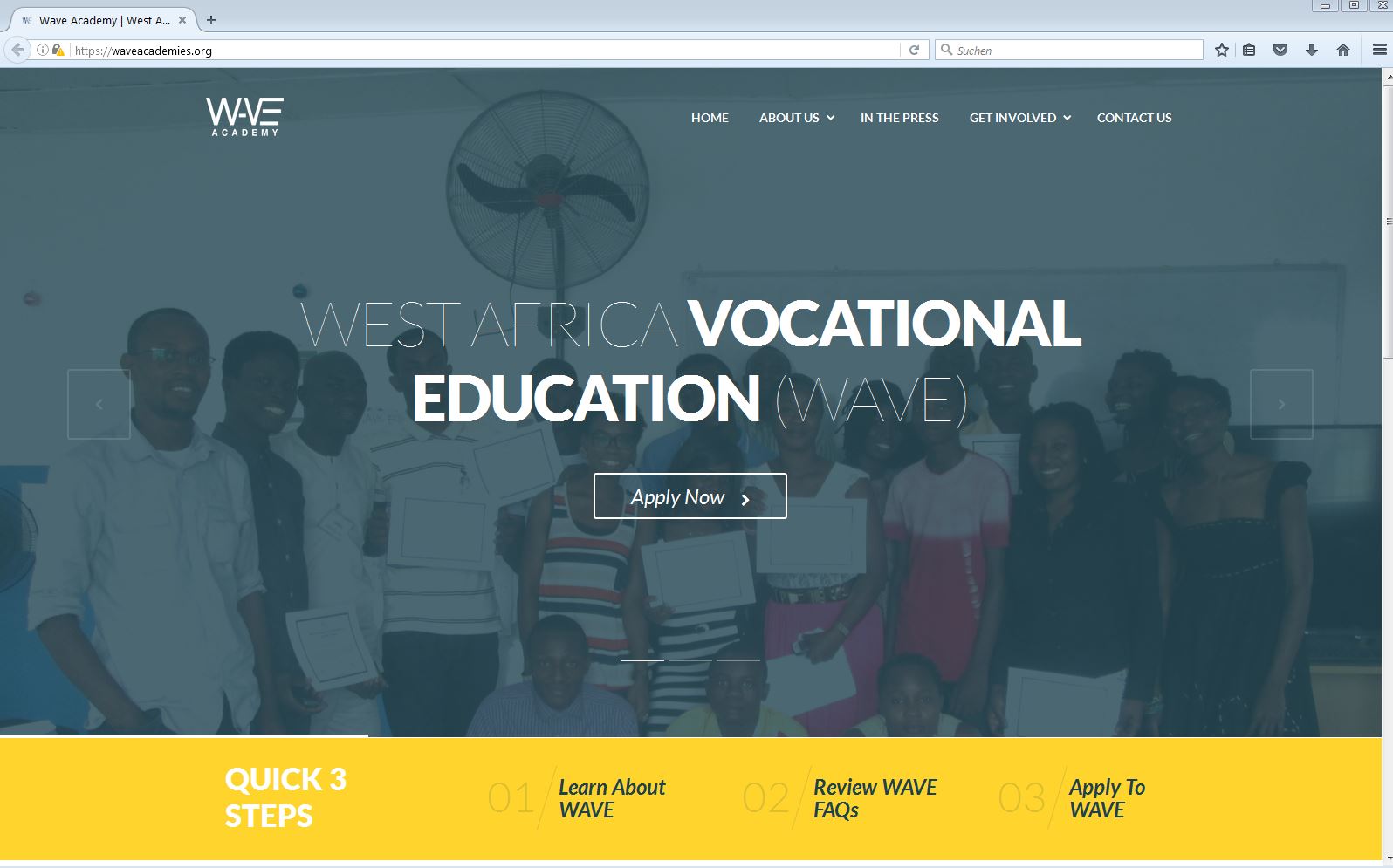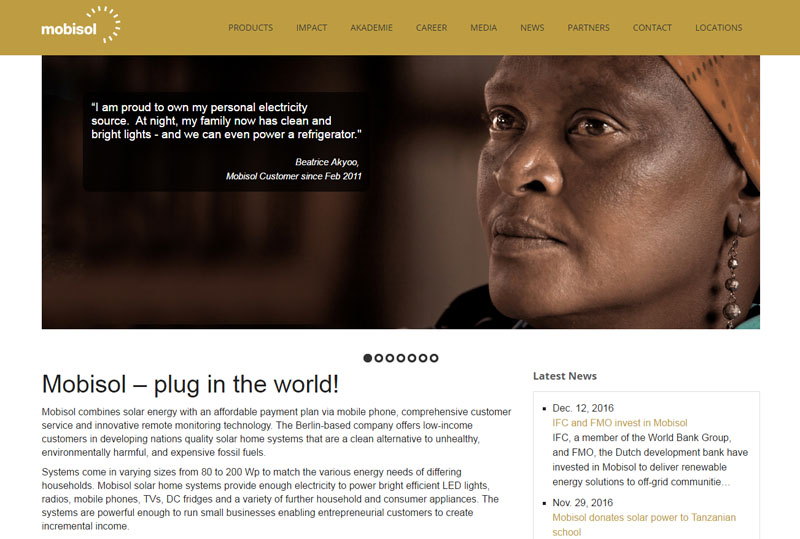Volkswirtschaftliche Entwicklung
Es hätte schlimmer kommen können
[ Von Kathrin Berensmann ]
Die meisten Länder südlich der Sahara sind mit der globalen Finanzkrise der vergangenen Jahre besser zurechtgekommen als zunächst erwartet. Die Wachstumsraten brachen oft nicht so stark ein wie befürchtet, und sie erholten sich schneller, als dies nach früheren Krisen der Fall war. Die hohen Expansionsraten von 2007 wurden noch nicht wieder erreicht. Insgesamt entsprach der Trend in Subsahara-Afrika im Großen und Ganzen dem globalen Trend – allerdings auf höherem Niveau.
Besonders hart traf die Krise afrikanische Länder mit mittleren Einkommen, da diese am stärksten in den internationalen Handel integriert sind. Der Rückgang der Exporte 2009 ging einher mit geringeren Zuwächsen der realen inländischen Nachfrage und der inländischen Investitionen (IMF, 2010a, S. 6). Die makroökonomischen Daten allein geben allerdings keinen vollständigen Aufschluss über die sozialen Folgen, die in ärmeren Ländern generell gravierender sind als in Ländern, die über soziale Sicherungsnetze verfügen.
Schnelle Erholung
Für den relativ schnellen Aufschwung südlich der Sahara gab es externe und interne Ursachen. Zu Ersteren gehört vor allem die relativ schnelle Erholung der gesamten Weltwirtschaft und des Welthandels, dessen Volumen voriges Jahr um 12,5 Prozent sank, aber dieses Jahr wieder um rund sechs Prozent ansteigen dürfte (OECD, 2010, S. 9). Auch zogen die meisten Rohstoffpreise seit Anfang/Mitte 2009 wieder an.
Eine wichtige interne Grundlage der schnellen Erholung war die überwiegend solide Wirtschaftspolitik vor der Krise. Viele Länder hatten eine stabilitätsorientierte Fiskal- und Geldpolitik betrieben und wiesen zu Beginn der Krise nur geringe Haushaltsdefizite oder sogar Haushaltsüberschüsse auf. Folglich hatten ihre Regierungen Spielraum für antizyklische Fiskalpolitik. Dazu trugen auch relativ niedrige Inflationsraten und relativ hohe Währungsreserven bei (IWF, 2010a und 2010b).
Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass sich besonders in den Öl exportierenden Ländern die Haushaltslagen im Durchschnitt erheblich verschlechtert haben. Generell litten die Staatseinnahmen unter der niedrigeren wirtschaftlichen Aktivität, während die Staatsausgaben anstiegen. Im Schnitt wiesen die Öl exportierenden Staaten südlich der Sahara 2008 Budgetüberschüsse von 5,9 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung (BIP) auf; im Jahr darauf waren dagegen Defizite von 7,8 Prozent zu verzeichnen. In den Ländern mit mittlerem Einkommen stiegen die Haushaltsdefizite im Schnitt von 0,5 Prozent des BIP 2008 auf 5,5 Prozent 2009 (IWF, 2010b, S. 80).
Südlich der Sahara beeinträchtigte die Krise den privaten Zustrom an Kapital weniger stark als in anderen Weltregionen. Das lag vor allem daran, dass die afrikanischen Finanzmärkte relativ schwach entwickelt und folglich für kurzfristig denkende Portfolioanleger nicht attraktiv sind. In diesen Ländern dominieren langfristige Direktinvestitionen, die nicht über Nacht abgezogen werden können.
Zwischen 2007 und 2009 nahmen die gesamten privaten Kapitalzuflüsse in die Länder südlich der Sahara zwar um 57 Prozent ab. Das ist aber gemessen am Rückgang um 72 Prozent für alle Entwicklungs- und Schwellenländer relativ wenig. Positiv war zudem, dass die Heimatüberweisungen von Migranten 2009 nur um drei Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen. Experten hatten einen stärkeren Rückgang befürchtet (IWF, 2010a, S. 48–51).
Soziale Folgen der Krise
Trotz des relativ positiven makroökonomischen Szenarios dürfen die sozialen Konsequenzen der Krise nicht unterschätzt werden. Grundsätzlich haben frühere Krisen gezeigt, dass sich soziale Indikatoren in Rezessionen schnell verschlechtern und in Boomphasen nur langsam wieder erholen. Dies ist besonders auf zwei Gründe zurückzuführen: schwache Institutionen, die soziale Maßnahmen nicht effizient und effektiv umsetzen, und geringere Sozialausgaben in Rezessionen (IWF/Weltbank, 2010a, 29).
Nach Schätzungen von Weltbank und IWF (2010b, S. 14–15) wird die Armutsrate in der Region 2015 nun 38 Prozent betragen – statt der vor der Krise erwarteten 35,9 Prozent. Das entspräche zusätzlichen 20 Millionen Menschen, die täglich mit weniger als der Kaufkraft von 1,25 Dollar auskommen müssen. Diese Prognose ist allerdings mit Skepsis zu bewerten. Es ist zu früh, um die vollständigen Auswirkungen der Krise auf die MDG-Agenda abzuschätzen. Die nötigen Daten konnten noch gar nicht vollständig erhoben werden. Viele Folgen werden erst im Laufe der Zeit sichtbar. Schlechte Ernährung heute wird beispielsweise höhere Kinder- und Müttersterblichkeit nach sich ziehen. Ähnlich führt heute versäumter Schulbesuch zu niedrigeren Abschlussraten und damit zu schlechteren Erwerbschancen in der Zukunft (IWF/WB, 2010a).
Neuere Schätzungen der Weltbank und des IWF ergaben, dass die Nahrungsmittelkrise 2008 die Zahl der unterernährten Personen um 63 Millionen Menschen und die globale Finanzkrise um 41,3 Millionen Menschen auf der ganzen Welt erhöht hat. Darüber hinaus ist die Kindersterblichkeit infolge der Finanzkrise im südlichen Afrika wohl um zusätzliche 30 000 bis 50 000 Todesfälle angestiegen.
Es ist vor allem wegen der großen Bedeutung des informellen Sektors südlich der Sahara sehr schwierig, präzise Arbeitslosenzahlen zu erheben. Arbeitslosenzahlen können nur im formellen Sektor erhoben werden. Zugleich ist klar, dass die globalen Turbulenzen erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigung hatten. In Südafrika allein wurden im Jahr 2009 etwa 900 000 Jobs gestrichen. Jobverluste im informellen Sektor haben noch härtere Konsequenzen. Die Menschen, die hier betroffen sind, haben in der Regel keine soziale Sicherung außer der Unterstützung durch Angehörige und Nachbarn (IWF, 2010a, S. 4).
Erfolgreich waren südlich der Sahara vor der Krise insbesondere „Cash transfer“-Programme für ärmere Bevölkerungsschichten. Sie wirken schnell und können gezielt und kurzfristig eingesetzt werden. Angola und Südafrika gehören zu der wachsenden Zahl von Ländern, in denen es solche Programme gibt. Allerdings bleibt ihr Umfang meist gering; oft handelt es sich auch nur um Pilotprogramme (IWF, 2010a).
Es bleibt also notwendig, die sozialen Sicherungssysteme in Subsahara-Afrika weiter auszubauen. Diese Region ist nur bedingt in der Lage, externe Schocks wie Finanzkrisen oder stark schwankende Nahrungsmittel- und Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt aufzufangen.
Anhaltende Risiken
Es darf auch nicht übersehen werden, dass die wirtschaftliche Erholung südlich der Sahara mit externen und internen Risiken verbunden ist. Es besteht die Gefahr, dass sich die Weltkonjunktur wieder verschlechtert („double-dip recession“), was auch die Erholung in Afrika wieder verlangsamen würde. Die Finanzmärkte einiger Industrieländer wirken weiterhin fragil, zudem bleibt das Wachstum in manchen reichen Nationen noch recht schwach. Außerdem sind die Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt immer noch sehr volatil. Auch das impliziert Risiken für afrikanische Volkswirtschaften.
Problematisch sind auch die hohen Haushaltsdefizite der meisten Industrieländer. Wenn deren Regierungen aber zu früh auf Sparpolitik zur Konsolidierung der Staatshaushalte setzen, kann das viele Volkswirtschaften weiter in die Rezession treiben und den Aufschwung ihrer Handelspartner weiter verzögern – und vielleicht sogar abwürgen. Kürzungen der Entwicklungshilfe im Zuge der Sparpolitik würden viele Länder südlich der Sahara hart treffen, weil sie besonders von diesen Mitteln abhängen.
Zu den internen ökonomischen Risiken gehören in afrikanischen Ländern die gestiegenen Defizite der Staatshaushalte, die in manchen Fällen schon wieder bedrohlich hoch sind. Sparpolitik zur Budgetkonsolidierung würde aber den konjunkturellen Aufschwung dämpfen. Andererseits beunruhigt auch die Aussicht auf Wahlen in 17 von insgesamt 44 afrikanischen Ländern südlich der Sahara einige Fachleute. Obwohl es schwierig ist, systematische politische Konjunkturzyklen nachzuweisen, ist klar, dass in dem einen oder anderen Land wichtige fiskalpolitische Konsolidierungsmaßnahmen hinausgezögert werden könnten (IWF, 2010b).
Ohne Zweifel ist langfristig die weitere Diversifizierung der Exporte notwendig, damit exogene Schocks, wie etwa fallende Rohstoffpreise, die Länder nicht einseitig treffen. Es wäre auch falsch, unterentwickelte Finanzsysteme für eine Stärke zu halten, nur weil die ärmsten Länder Afrikas von schwankenden Kapitalzuflüssen relativ wenig beeinträchtigt wurden. Die Kehrseite ist nämlich, dass diese Länder ohne die positiven ökonomischen Wirkungen eines starken Finanzsektors auskommen müssen. Anders formuliert: Sie leben grundsätzlich auf einem deutlich ärmeren Niveau als Länder mit mittleren Einkommen.