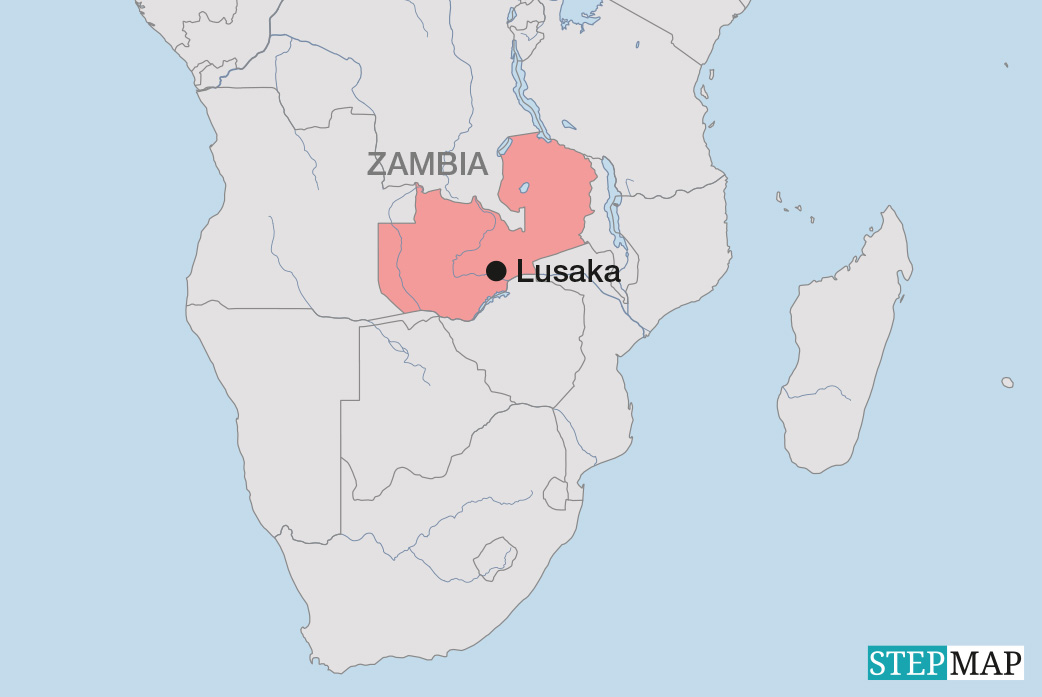Multilateralismus
Eine kühne Haltung

In diesem Jahr sind die Vereinten Nationen 80 Jahre alt geworden. Bei der Generalversammlung (UNGA) im September in New York konzentrierten sich die Staats- und Regierungschef*innen der Welt auf dringliche Themen wie anhaltende Konflikte, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte. Das Motto des Jubiläumsjahres, „Better Together“, könnte nicht passender sein – und zugleich keinen größeren Gegensatz zur Realität darstellen.
Die UNGA hat verdeutlicht, wie uneinig die Welt tatsächlich ist. Die Versammlung war geprägt von versteckten Sticheleien, Beschwerden, Bitten und offenen Meinungsverschiedenheiten – alles vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen: die Lage in Gaza, die Kriege im Sudan und in der Ukraine, der an Fahrt aufnehmende Klimakollaps. Und, wie der US-Präsident in seiner Rede anmerkte, angesichts defekter Teleprompter und Rolltreppen.
Die Haltung der afrikanischen Staats- und Regierungsoberhäupter entsprach der aufgeheizten Stimmung. Standhaft brachten sie ihre Beschwerden vor, forderten faire Repräsentanz und eine inklusive globale Regierungsführung, insbesondere im UN-Sicherheitsrat, dem wichtigsten Entscheidungsgremium der Organisation. Diese Anliegen waren nicht neu, aber diesmal lauter und ungeduldiger.
Scheitern wie der Völkerbund?
Ganz oben auf der Beschwerdeliste standen die Vereinten Nationen selbst. Die afrikanischen Vertreter*innen kritisierten deren exklusive Struktur, die den Kontinent weiterhin zur Seite drängt. Der kenianische Präsident William Ruto zog in seiner Rede eine historische Parallele zum Völkerbund und erinnerte daran, dass dieser den Zweiten Weltkrieg nicht verhindern konnte. Das müsse Lehre und Warnung sein, sagte er und betonte, wie wichtig es sei, internationale Institutionen neu zu konzipieren und zu reformieren, damit sie integrativer, reaktionsfähiger und den globalen Herausforderungen von heute besser gewachsen sind. Er forderte eine Umstrukturierung des UN-Sicherheitsrats mit mindestens zwei ständigen afrikanischen Mitgliedern.
Ruto fragte offen, ob die UN in ihrer aktuellen Form noch den Anforderungen unserer Zeit gerecht werde – und ob sie der Menschheit angesichts der heutigen globalen Realitäten noch dienen könne. Die provokante Frage fand große Resonanz und wurde von vielen Redner*innen aus Afrika aufgegriffen.
Der ghanaische Präsident John Dramani Mahama befand die UN-Charta hinsichtlich des Aspekts der Repräsentation für veraltet. Er wies darauf hin, dass die Nachkriegsmächte noch immer unverhältnismäßig viel Einfluss hätten – im krassen Gegensatz zu Artikel 1 der Charta, der die souveräne Gleichheit aller Mitgliedstaaten hervorhebt.
Mahama äußerte sich zurückhaltender als sein ostafrikanischer Amtskollege, forderte aber mindestens einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für Afrika. Zudem führte er an, das Vetorecht dürfe nicht ausschließliches Privileg einiger weniger Staaten bleiben und auch nicht absolut sein. Er schlug einen Mechanismus innerhalb der UN vor, um die Anwendung von Vetos zu überprüfen oder anzufechten – im Sinne von Fairness und Rechenschaftspflicht.
Der namibische Präsident Netumbo Nandi-Ndaitwah betonte nachdrücklich, wie wichtig es sei, den Ezulwini-Konsens aufrechtzuerhalten, der belegt, dass Afrika bereits seit 20 Jahren eine stärkere Repräsentanz fordert. Der 2005 verabschiedete Konsens beinhaltet die einheitliche Position der Afrikanischen Union hinsichtlich der Notwendigkeit einer UN-Reform, die Afrika eine gerechte Repräsentanz zugesteht.
Der Präsident von Südafrika, Cyril Ramaphosa, bekräftigte, was sein Land seit Langem beklagt: die Ineffektivität des UN-Sicherheitsrats und den Verlust seine Glaubwürdigkeit bei der Durchsetzung des Völkerrechts. Noch schärfer war die Kritik von Premierminister Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo aus Burkina Faso. Er warf dem Rat vor, sich für politische Ziele und Rache missbrauchen zu lassen, statt Frieden und Gerechtigkeit zu fördern. Er forderte einen ständigen Sitz für Afrika, um Gleichgewicht und Legitimität in der globalen Regierungsführung wiederherzustellen.
Ein wichtiger Kritikpunkt der afrikanischen Staats- und Regierungsoberhäupter war auch die in den internationalen Finanzsystemen verankerte Ungleichheit, insbesondere mit Blick auf den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. So bemängelte etwa der kenianische Präsident Ruto, dass die derzeitigen Strukturen oft wirtschaftliche Ungleichheiten perpetuierten und dass „die derzeitige globale Finanzarchitektur arme Länder bestraft und die reichen belohnt“.
Was folgt den Worten?
All diese kühnen Aussagen werfen einige Fragezeichen auf. Die Ansichten der Staats- und Regierungschef*innen spiegeln zwar gewiss die Frustrationen und Hoffnungen vieler Afrikaner*innen wider. Doch stellt sich die Frage, ob die Welt wirklich bereit ist, ihre kühnen Worte zur UN-Reform in die Tat umzusetzen oder ob die Forderungen nach Gerechtigkeit erneut in der üblichen Kakophonie inhaltsleerer Rhetorik versickern. Wird dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein der Vertreter*innen Afrikas endlich zu sinnvollen Maßnahmen führen?
Doch selbst wenn der Ruf nach Reformen Gehör finden würde: Könnten sich die afrikanischen Staaten darauf einigen, wer die ständigen Sitze im Sicherheitsrat besetzen soll? Der nigerianische Vizepräsident Kashim Shettima ließ wenig Zweifel daran, dass sein Land einen der Sitze beanspruchen werde. Wahrscheinlich sollte der Rest des Kontinents klären, wer den anderen übernimmt. Oder sollten sich die Staaten abwechseln? Seien wir ehrlich: Ein Konsens darüber ist eine enorme Herausforderung. Wer entscheidet also – und nach welchen Kriterien?
Und wenn die Welt diese Forderungen weiterhin ignoriert – was dann? Wird Afrika den Mut haben, den Status quo zu durchbrechen, seine Rolle innerhalb des UN-Systems zu überdenken oder gar einen unabhängigen Kurs einzuschlagen, der sein wachsendes globales Selbstbewusstsein widerspiegelt? Ehrlich gesagt, bezweifle ich das.
Vielleicht ist die wichtigere Frage jetzt, ob das wachsende Selbstbewusstsein Afrikas auf der Weltbühne die Beziehungen zu seinen traditionellen westlichen Partnern belasten wird. Das gilt insbesondere angesichts der fortlaufenden und verheerenden Kürzungen im Bereich Nothilfe und Entwicklung, verkörpert durch den jüngsten Aufruhr um den Rückzug von USAID.
Die diesjährige UN-Generalversammlung signalisiert aber einen Wandel. Es herrscht Aufbruchstimmung: Afrika hat es satt, auf Erlaubnis zu warten, Führung zu übernehmen – zumindest auf dem Papier. Seine Vertreter*innen sprachen ungewöhnlich überzeugt und forderten einen fairen Anteil an der globalen Entscheidungsmacht statt symbolischer Gesten.
Aber mutigen Worten müssen mutige Taten folgen. Wird sich Afrikas Selbstbewusstsein in einem gemeinsamen Reformwillen zeigen, oder wird zurückgerudert aus Angst, Gebergelder und ausländische Hilfe zu verlieren?
Miriam Ogutu ist eine panafrikanische Journalistin und Expertin für strategische Kommunikation sowie die Analyse internationaler Beziehungen.
missogutu@gmail.com