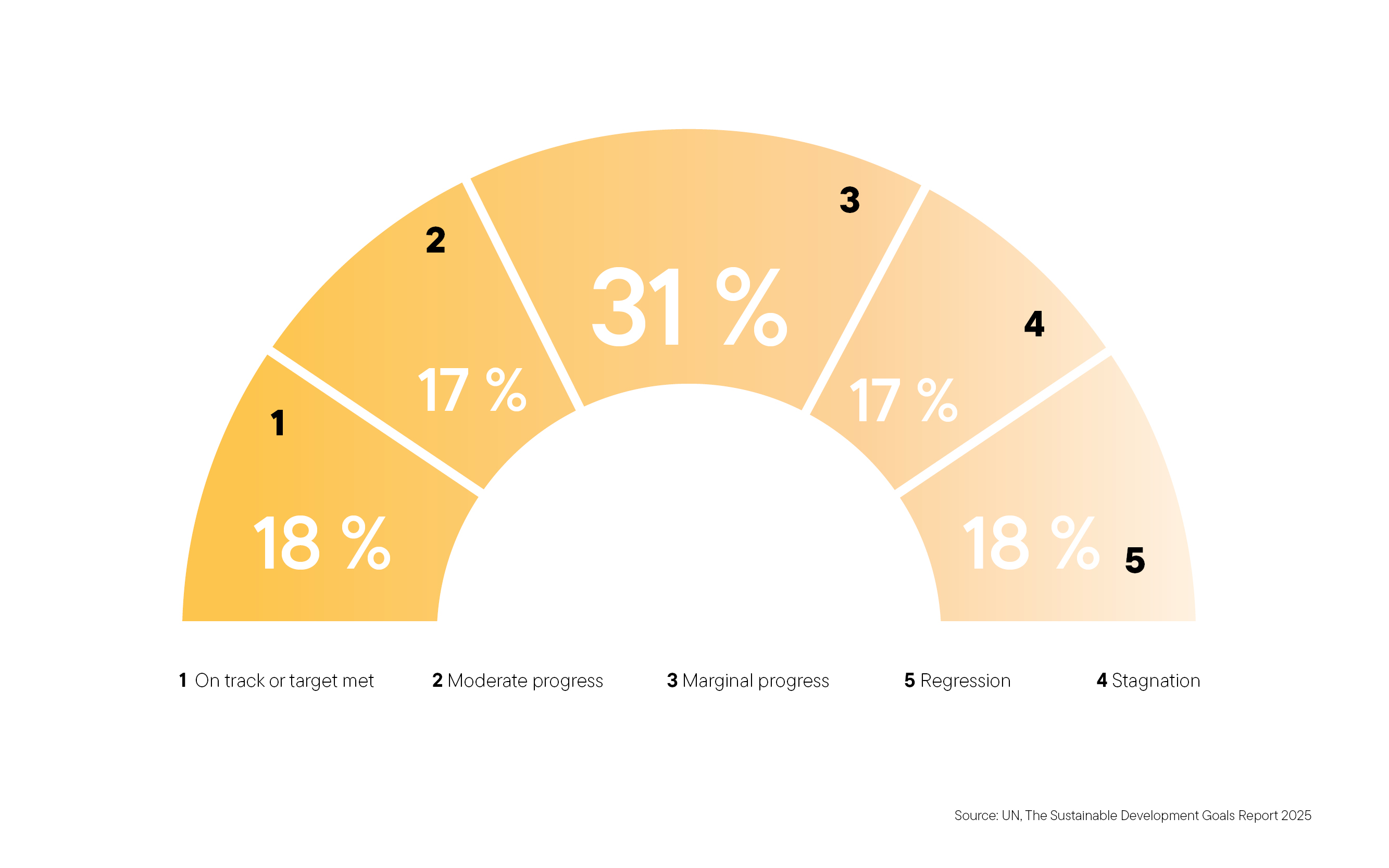Viel heiße Luft
[ Von Craig Morris ]
Welches Land installierte letztes Jahr die höchste Windkraftkapazität? Die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wo wurde die erste Börse für Emissionszertifikate eröffnet? 2003 in Chicago.
Zugegeben, die Klimabörse in Chicago ist nach wie vor eine freiwillige Angelegenheit. Der Emissionshandel in der EU ist 200-mal so groß. Aber einige Neuenglandstaaten beraten sich mit Kalifornien darüber, den Emissionshandel verbindlich zu machen – dann müsste auch Washington bald folgen. Zudem fördern rund 20 Bundesstaaten erneuerbare Energien. Auch lokale Behörden fördern erneuerbare Energien – zum Beispiel im 8000-Seelen-Ort Sebastopol in Kalifornien, der sich das Ziel gesetzt hat, ein Megawatt Strom durch Solaranlagen auf städtischen Gebäuden zu produzieren.
Die USA sind noch in Bezug auf einen anderen, weniger bekannten Aspekt der Energieversorgung Vorreiter: das Nachfragemanagement. Von jeher wird Strom entsprechend dem Bedarf produziert – die Stromwerke mussten also bislang stets die erwarteten Nachfragespitzen abdecken können. Doch die Blackouts in Kalifornien im Jahr 2000 und der große Stromausfall im Nordosten im August 2003 haben die Grenzen dieses Ansatzes aufgezeigt. Seitdem versuchen die Versorger die Nachfrage besser über den Tag zu verteilen, um Versorgungsengpässen entgegenzuwirken. So erlässt beispielsweise die Stadt Austin/Texas Haushalten die monatlichen Anschlussgebühren, wenn sie dem kommunalen Versorger erlauben, während Versorgungsspitzen für einige Minuten die Klimaanlagen abzuschalten. Die Verbraucher sparen Geld, der Versorger muss kein zusätzliches Kraftwerk bauen, und Stromausfälle werden vermieden.
Langfristig ermöglicht es solches Nachfragemanagement, schwankende Erträge aus erneuerbaren Energiequellen ins Stromnetz zu integrieren. Der Wind bläst eben nicht den ganzen Tag, und auch die Sonne scheint nicht immer. Wir müssen unseren Verbrauch diesen Schwankungen anpassen. Initiativen auf einzelstaatlicher und kommunaler Ebene werden die USA in diesem Bereich an die Spitze bringen.
Amory Lovins vom Rocky Mountain Institute trommelt seit über zwei Jahrzehnten für derartige innovative Ansätze. Er plädiert für „Least-Cost Planning“ (LCP) – also für möglichst kosteneffiziente Lösungen. Ist es billiger, ein neues Kraftwerk zu bauen oder den Verbrauchern kompakte Leuchtstofflampen anzubieten, um Stromspitzen zu kappen? Viele multinationale Unternehmen, von Dupont bis IKEA, sparen seit langem Kosten durch LCP, aber es musste erst zu den jüngsten Stromausfällen kommen, um auch die Energieversorger auf Trab zu bringen.
Flotte Rhetorik, schleppende Reformen
Umweltschützer in den USA erzählen gern, wie bestimmte Vorfälle in den letzten Jahren die Einstellung der Amerikaner verändert haben. Zum Beispiel hätte noch vor kurzem niemand erwartet, dass ein Politiker, der aus der Öffentlichkeit verschwunden war, mit einer Diashow irgendetwas bewirken würde. Doch Al Gores Film über den Klimawandel wurde ein Kassenschlager.
2005 suchten Katrina und Rita die Golfküste der USA heim. Diese beispiellose Hurrikan-Saison schien die schlimmsten Warnungen der Klimaforscher zu bestätigen. Außerdem deckten die Stürme eine weniger bekannte Schwachstelle des Landes auf: die Abhängigkeit von der Ölproduktion im Golf von Mexiko, die ernsthaft gestört war. Auch der Schlamassel im Irak hat jenen Leuten mehr Gehör verschafft, denen zufolge es in diesem Krieg vor allem ums Öl geht. Gleichzeitig wurde deutlich, wie gefährlich aus geostrategischer Sicht eine Abhängigkeit von diesen Energiereserven ist.
Diese Vorfälle und Ereignisse haben vielleicht zu einem Umschwung der öffentlichen Meinung geführt, wirklich etwas geändert haben sie nicht. LCP und die vorbildlichen Ansätze amerikanischer Energiepolitik gab es bereits vor Gores Film und dem Irak-Krieg. Ein Beispiel ist die Windkraft. Ihr Erfolg ist dem so genannten Production Tax Credit (PTC) zu verdanken: Betreiber von Windturbinen können 1,9 Cent pro produzierter Kilowattstunde von der Steuer abschreiben. Den PTC gibt es aber seit 1992, nur lief er immer wieder aus und wurde jeweils mit Verspätung verlängert. Erst seit einigen Jahren kann sich die Branche sicher sein, dass das Programm bruchlos weiterläuft.
Präsident George Bush pries sein Energiegesetz von 2005 als Versuch, die Abhängigkeit des Landes von Energieimporten zu vermindern. Allerdings erleichtert es den Bau von neuen Docks für die Einfuhr von verflüssigtem Erdgas sowie von Raffinerien für noch mehr Rohölimporte. Zwar soll auch die heimische Ölförderung gesteigert und die Entwicklung sauberer Kohlekraftwerke gefördert werden, was beides die Importabhängigkeit lindern würde. Doch es gab bislang keine ernsthafte Initiative, den Verbrauch zu drosseln oder auf heimische erneuerbare Energie umzusteigen. Während erneuerbare Energien über zehn Jahre gestreckt Steuervergünstigungen in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar erhielten, wurden der Wasserstoffforschung in nur fünf Jahren 1,7 Milliarden Dollar gewährt. Es wäre falsch zu erwarten, dass Präsident Bush seiner neuen grünen Rhetorik entsprechende Taten folgen lässt.
Wie sieht es auf bundesstaatlicher Ebene aus? Arnold Schwarzenegger, Gouverneur von Kalifornien, ist allseits bekannt als Verfechter von Maßnahmen gegen die Erderwärmung. Nach den Wahlen im vergangenen November erklärte der Umweltexperte Mark Hertsgaard: „Schwarzenegger war einer der wenigen Lichtblicke für die Republikaner. Er errang einen Erdrutschsieg im größten Bundesstaat, vor allem weil er sich als Grüner verkaufte.“ Seine Umweltpolitik sieht tatsächlich gut aus. Letztes Jahr verabschiedete Kalifornien den Global Warming Solutions Act (AB32) zur Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 25 Prozent unter den Wert von 1990. Am 1. Januar 2007 trat die California Solar Initiative (CSI) in Kraft. Ihr Ziel: eine Million Solardächer bis 2017.
Aber vieles davon ist nur heiße Luft. Ziele setzen kann jeder, doch wie sieht es mit den Mechanismen aus, sie zu erreichen? Gibt es Sanktionen bei Nichterfüllung? Nicht im Gesetz gegen die Klimaerwärmung. Bis 2009 hat Kalifornien Zeit, sich zu überlegen, wie es das darin definierte Ziel erreichen will. In den nächsten zwei Jahren wird also nicht viel passieren. Auch von der Solar-Initiative sollte man nicht allzu viel erwarten. 1997 unter Präsident Clinton startete das US-Energieministerium sein eigenes „Million Solar Roofs“-Programm. Es war bis 2010 angelegt, wurde aber – weit vom Ziel entfernt – bereits abgebrochen. 2003 berichtete ein Journalist, die Statistiken seien so schlecht, dass die Website des Programms gar nicht erst mit Inhalten gefüllt worden sei; 2006 wurde sie vom Netz genommen.
Politik ohne Biss
Leider hat der Bundesstaat Kalifornien schon früher seine Ziele verfehlt. 1990 verlangte er von den Automobilherstellern, 10 Prozent aller in Zukunft in Kalifornien verkauften Autos sollten abgasfrei sein. Also kümmerten sich General Motors und Ford gar nicht erst um die Entwicklung von Hybridautos, weil diese sowohl mit Batterie als auch mit Benzin betrieben werden und deshalb weiter Schadstoffe ausstoßen. Heute sind die Hybridfahrzeuge von Toyota der letzte Schrei, und die krisengeschüttelten Autobauer aus Detroit versuchen krampfhaft das Versäumte nachzuholen.
Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass die japanischen Hersteller eigentlich dazu übergegangen waren, nicht mehr ihre kleinen, benzinsparenden Autos in die USA zu exportieren, sondern Luxuslimousinen – und zwar trotz einer Vorschrift auf Bundesebene zur Erhöhung der Energieeffizienz von Autos (Corporate Average Fuel Economy, CAFE). Die CAFE-Sanktionen waren einfach zu lasch – in zwanzig Jahren ist es nicht gelungen, den durchschnittlichen Benzinverbrauch signifikant zu senken. Selbst das Modell A von Ford aus den späten 20er Jahren des letzten Jahrhunderts würde die CAFE-Standards erfüllen.
Leider hat die amerikanische Politik zur Förderung erneuerbarer Energien häufig keinen Biss. Texas beispielsweise will bis 2015 Produktionskapazitäten für 5880 Megawatt installieren – das entspricht rund fünf Prozent des Gesamtbedarfs. Andere Staaten haben sich prozentuale Ziele gesetzt: Kalifornien strebt 20% an; Maine setzte sich 1999 sogar 30% zum Ziel. Allerdings stellte sich dann heraus, dass Maine diesen Anteil bereits erreicht hatte, als das Gesetz verabschiedet wurde. 2001 produzierte der Staat 17 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft und 25 Prozent aus Biomasse. Und der größte Witz ist: Seit der Verabschiedung des Gesetzes wurde nichts unternommen, es entsprechend zu ändern.
Andere Bundesstaaten wie Minnesota geben freiwillige Ziele vor, die nicht sanktioniert sind. Wieder andere hängen die Strafen so niedrig, dass es billiger ist, zu bezahlen, als in erneuerbare Energien zu investieren. In manchen Staaten wiederum sind die Sanktionen so hart, dass sie schon wieder unwirksam sind. So könnte einem Energieversorger zum Beispiel die Betriebserlaubnis entzogen werden. Man stelle sich vor, ein Energieversorger müsste dicht machen und informierte seine Kunden über batteriebetriebene Radios, die Regierung habe ihn dazu gezwungen, weil ein paar Windräder nicht installiert worden seien. Politiker werden alles tun, dass es zu einer solchen Situation nicht kommt – die Sanktion ist also eine leere Drohung.
Aus gutem Grund kennt die kalifornische Solar-Initiative keine Sanktionen. Sie basiert teilweise auf Anreizen, die an der zu erwartenden Leistung ansetzen. Solarsysteme in Privathaushalten und in Betrieben werden mit 2,50 Dollar pro Watt erwarteter Spitzenleistung subventioniert. Kommunale und gemeinnützige Organisationen mit Kapazitäten von bis zu 100 Kilowatt erhalten 3,50 Dollar. Das bedeutet, Anlagen mit weniger als 100 Kilowatt Leistung (die durchschnittliche Leistung von Anlagen in Privathaushalten liegt bei 3-4 kW) werden teilweise vorfinanziert.
Das ähnelt dem deutschen „100 000 Solardächer“-Programm aus den 1990er Jahren. Die Deutschen stellten freilich irgendwann fest, dass dieser Ansatz einen großen Nachteil hat. Die Vorabförderung wurde gewährt, egal ob die Solarzellen im Schatten eines Baumes oder im vollen Sonnenlicht installiert waren. Kalifornien will deshalb bei kleinen Anlagen durch Stichprobenkontrollen eine sachgerechte Installation sicherstellen. Bei Systemen mit mehr als 100 Kilowatt Leistung richtet sich die Förderung ohnehin nach der tatsächlich produzierten Strommenge.
In anderen Teilen der USA ist ein anderes Solarprogramm in Kraft. Es nennt sich „Net-Metering“ und basiert auf der tatsächlichen Leistung und nicht auf einer Vorab-Förderung: Der produzierte Solarstrom wird mit der aus dem Netz bezogenen Energie verrechnet. Die Förderung hängt also vom Strompreis ab – und der liegt zwischen fünf Cent pro Kilowattstunde in Kentucky bis zu 20 Cent auf Hawaii.
Doch der Verkaufspreis entspricht weder den tatsächlichen Kosten von Solarstrom noch seinem Wert für das Stromnetz. Der meiste Solarstrom wird am frühen Nachmittag generiert, wenn viele Amerikaner ihre Klimaanlagen laufen lassen. Energieversorger müssen zu diesen Spitzenzeiten den Strom viel teurer auf Spotmärkten zukaufen. Das Net-Metering hat der Solarindustrie keinen Aufschwung gebracht, weil es deren Kosten nicht deckt.
US-Politiker stellen vor allem Energieziele auf, die sich in den Medien gut machen. Werden die Vorgaben verfehlt, werden sie aber aus dem Internet gelöscht. Abgesehen davon liegen die Ziele meistens so weit in der Zukunft, dass andere für das Scheitern verantwortlich sind. Das Problem ist also nicht, dass die USA sich keine ehrgeizigen Ziele setzen, sondern dass es keine Instrumente gibt, sie zu verwirklichen. Als gebürtiger Österreicher sollte Schwarzenegger eigentlich der Erste sein, der im Ausland nach besseren Ansätzen Ausschau hält. Er würde in vielen Ländern auf Ideen stoßen, die sich die USA zum Vorbild nehmen könnten.
Bessere Ansätze
Allein in der EU gibt es eine Vielzahl an energiepolitischen Ansätzen. Die Begrenzung von und der Handel nicht nur mit Emissionen, sondern auch mit „grünen Zertifikaten“ für erneuerbare Energien (Cap and Trade), wie es Britannien und Italien seit langem praktizieren, sind den US-amerikanischen Ansätzen sehr ähnlich – und auch diese beiden Länder haben mit erneuerbaren Energien nichts am Hut. Italien hat nicht einmal 10 Prozent der deutschen Kapazität installiert. In Britannien, dem EU-Land mit den besten Windverhältnissen, ist es sogar noch weniger. Deutschland, Dänemark und Spanien sind Vorreiter, weil sie den Herstellern von Öko-Strom Mindestpreise zahlen, so genannte Einspeisevergütungen. Alle drei Länder sind weltweit Spitze in der Windkrafterzeugung. Deutschland ist dank der gewährten Mindestpreise zudem Vorreiter im Bereich Photovoltaik. Inzwischen hat offenbar auch Italien seine Lektion gelernt: Seit Ende 2005 setzt es ebenfalls auf Mindestpreise.
Wenn die Amerikaner hinschauten, würde ihnen klar, dass dieser Ansatz marktbasiert ist und keine Sanktionen braucht. Einspeisevergütungen beruhen auf den tatsächlichen Kosten der jeweiligen Stromart. Sie sind verschieden hoch für Solarstrom, Biomasse und Windenergie und richten sich nicht nach dem Endverbraucherpreis für Strom. Der Staat muss die Tarife nicht weiter regulieren; er setzt lediglich das Preissignal und überläßt alles andere den Märkten. Deutschland kam die ersten fünfeinhalb Jahre nach der Liberalisierung der Erdgas- und Strommärkte ganz ohne Regulierungsbehörde aus. Im Juli dieses Jahres wird die Liberalisierung in der Europäischen Union abgeschlossen. Man vergleiche das einmal mit den Stromausfällen in den Vereinigten Staaten während der Deregulierung dort. Zudem hat die Europäische Union durch Preissignale den Benzinverbrauch gedrosselt. Benzin kostet etwa doppelt so viel wie in den USA, der Verbrauch dagegen ist nur halb so hoch.
Die Einspeisevergütung beruht außerdem auf einem Umlageverfahren, ähnlich wie die Sozialversicherung, wobei in diesem Fall die Bezahlung über die Stromrechnung erfolgt. Es gibt keinen Posten für die Einspeisevergütung der erneuerbaren Energien im Bundeshaushalt. Nach einem Regierungswechsel können neue Politiker, die Ausgaben reduzieren wollen, deshalb in diesem Bereich nicht kürzen.
Noch braucht es mehr als einen Al Gore, Hurrikane und einen Arnold Schwarzenegger, um die Amerikaner dazu zu bringen, ihren Verbrauch zu reduzieren oder auf erneuerbare Energien umzusatteln. Eines der größten Rätsel der derzeitigen US-Regierung ist, dass sie so viel über Energie weiß und so wenig damit anfängt.
Umweltschützer verehren den früheren Präsidenten Jimmy Carter, weil er einen Solarkollektor für warmes Wasser auf dem Dach des Weißen Hauses installieren ließ, den sein Nachfolger Ronald Reagan prompt wieder entfernte. Doch wer installierte die erste Solarstromanlage auf dem Weißen Haus? Niemand anderer als George W. Bush im Jahr 2002. Seine Ranch in Crawford, Texas, hat zudem eine geothermische Kühlanlage. Und während seiner Amtszeit als Gouverneur von Texas in den 1990er Jahren setzte er dort den nach wie vor anhaltenden Windkraft-Boom in Gang. Texas ist in Sachen Windkraft die Nummer 1 in den USA.
Bush kennt also die Vorteile hochmoderner Energietechnologien. Nächstes Jahr scheidet er aus dem Amt. Über die Frage, warum er sein Wissen über Geothermie, Windkraft und Sonnenenergie nicht in eine nachhaltige Bundespolitik umgesetzt hat, können sich dann die Historiker den Kopf zerbrechen.