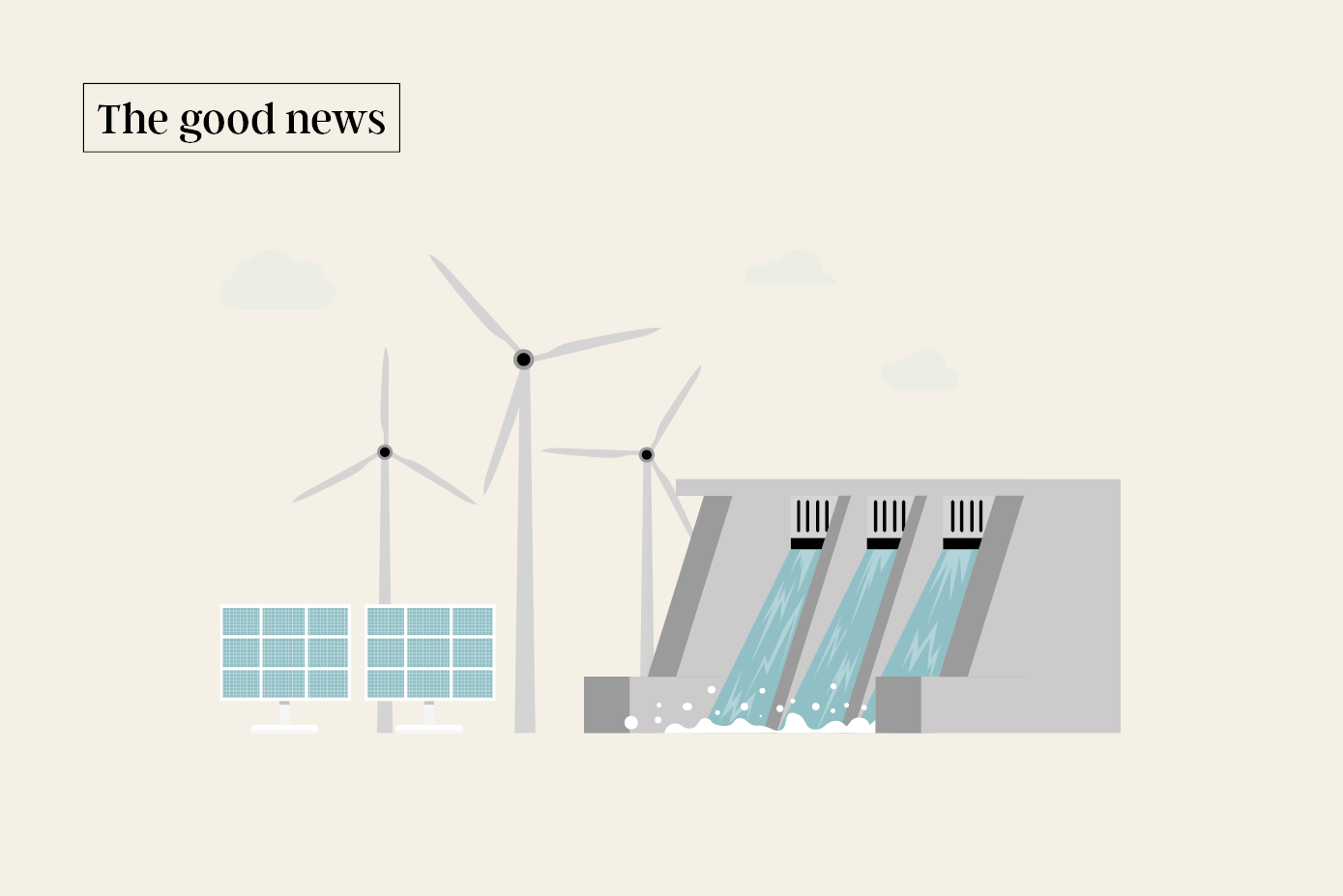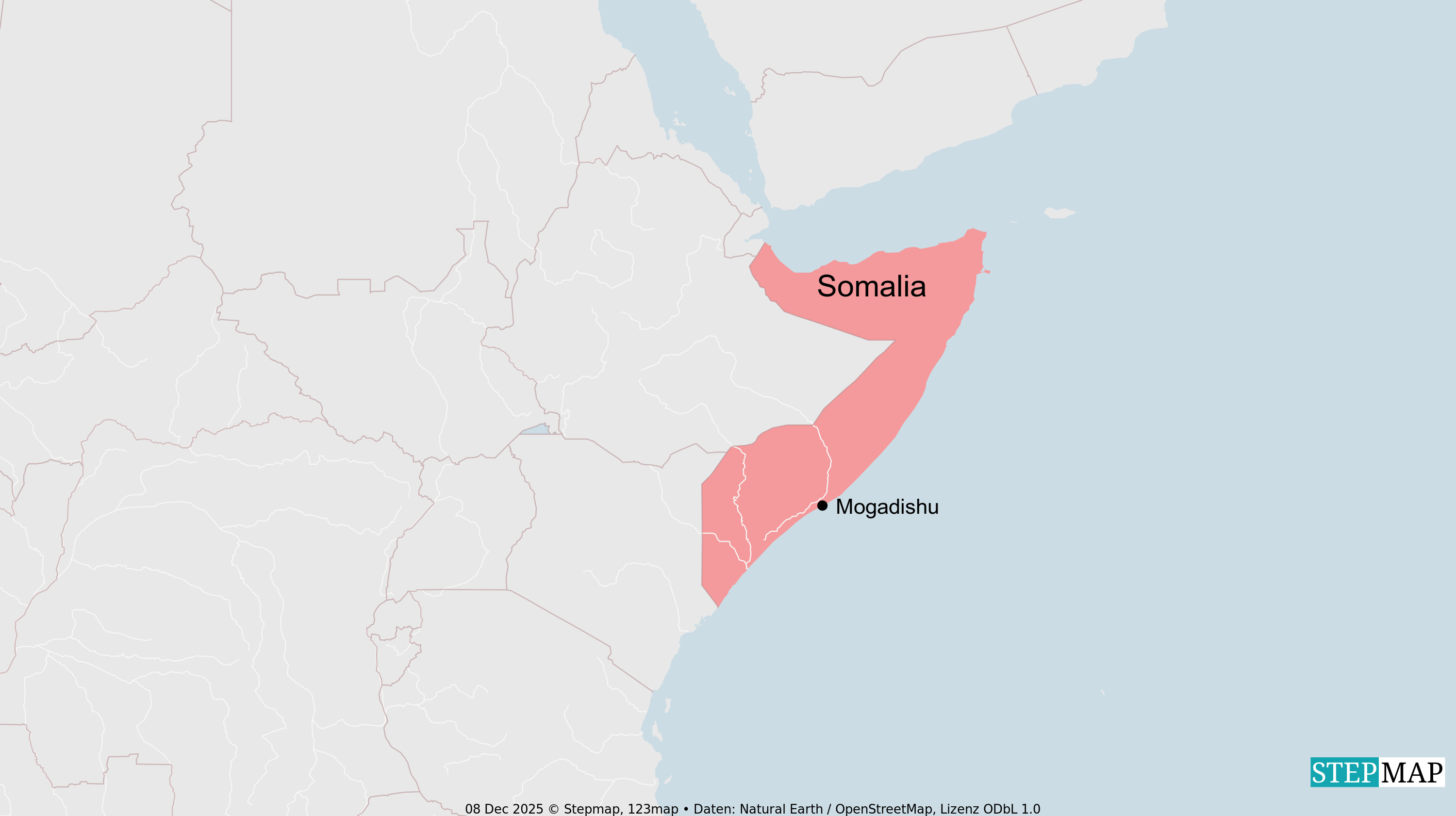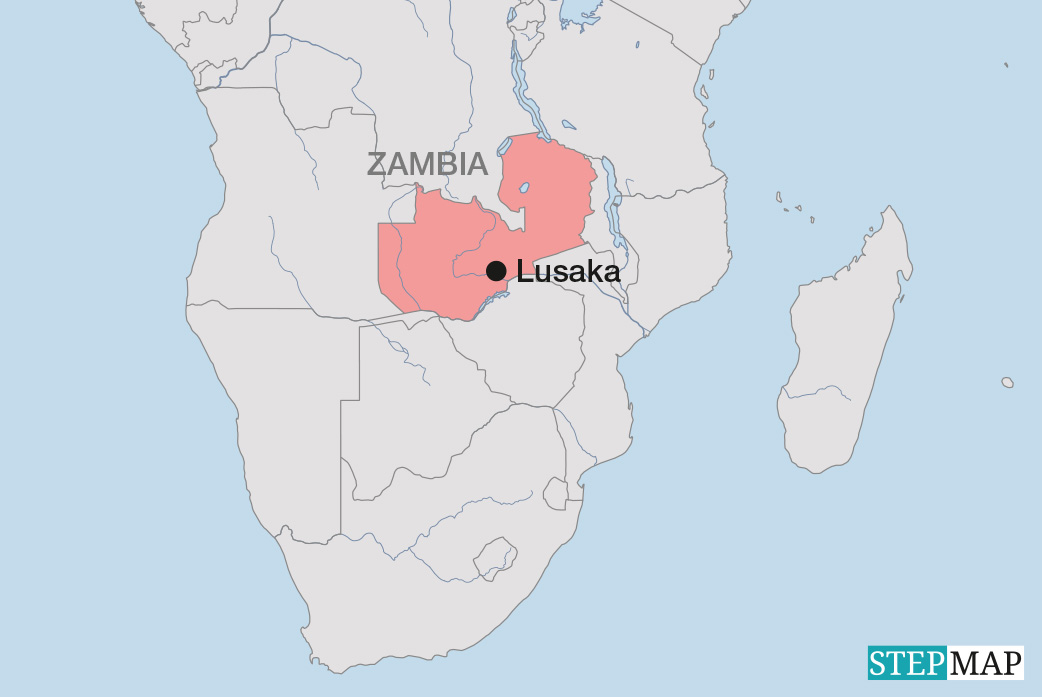Indigene Rechte
Weshalb selbst in Bolivien Indigenes Leben von vielen Seiten bedroht ist

Drei Stunden dauert die Bootsfahrt von Rurrenabaque, einer Kleinstadt am Fluss Río Beni im bolivianischen Tiefland, zum Dorf Asunción de Quiquibey. Der Río Beni ist die einzige Verkehrsader hier – Straßen gibt es nicht, die Dörfer am Ufer sind nur über den Fluss erreichbar.
Bolivien ist als Andenland bekannt, doch das täuscht: Fast die Hälfte der Landesfläche macht die „Amazonía“ aus, wie das tropische Tiefland genannt wird. Die größte Regenwaldregion der Welt, das Amazonasgebiet, beginnt direkt hinter den Anden. Der bolivianische Teil macht 6,6 Prozent der gesamten Fläche von 6,7 Millionen Quadratkilometern aus. Asunción de Quiquibey ist eines von insgesamt 23 Dörfern im Gebiet Pilón Lajas, das doppelten Schutzstatus genießt: als UNESCO-Biosphärenreservat und als vom bolivianischen Staat anerkanntes Indigenen-Territorium. Hier leben zwei indigene Gruppen zusammen: die Mosetén und die Tsimané. Ihre Häuser stehen im Wald verstreut auf Stelzen. Sie leben vom Wald und vom Fluss sowie von ein wenig Landwirtschaft für den Eigenbedarf. Fließendes Wasser, Strom oder Mobilfunkempfang gibt es in dem abgelegenen Gebiet nicht. Gekocht wird auf Holzfeuer in einer großen, offenen Gemeinschaftsküche. Dort befindet sich auch die Trinkwasserversorgung des Dorfes: Das Wasser kommt aus einer Quelle, die einige Kilometer entfernt ist, per Leitung hier an.
Staatliche Leistungen erreichen Pilón Lajas kaum
Bolivien sieht sich als Vorreiter, wenn es um die Rechte Indigener Völker geht. Unter Präsident Evo Morales, dem ersten Indigenen Staatsoberhaupt des Landes, wurde 2009 eine neue Verfassung verabschiedet. Die Kultur und Sprache von 36 verschiedenen Indigenen Ethnien sowie die Rechte der Natur – der Mutter Erde – werden darin anerkannt. Im selben Jahr wurde auch die offizielle Landesbezeichnung angepasst zu „Estado Plurinacional de Bolivia“ – Plurinationaler Staat Bolivien. Der Name sollte Programm sein.
Seitdem ist einiges passiert: Während der Amtszeit von Evo Morales halbierte sich die extreme Armut, die Einkommensungleichheit sank, die öffentliche Bildung und die Gesundheitsversorgung wurden ausgebaut.
Bei Gesprächen mit den Bewohner*innen von Asunción de Quiquibey wird jedoch schnell klar, dass sich die Mosetén und Tsimané vom bolivianischen Staat ziemlich alleingelassen fühlen. Von den 36 Völkern, die in Bolivien anerkannt sind, leben 32 im Amazonasgebiet. Theoretisch haben sie alle das Recht auf Bildung in ihrer Muttersprache. Doch in der Schule in Asunción de Quiquibey findet der Unterricht, wenn überhaupt, auf Spanisch statt. Bis der Staat ausreichend Lehrkräfte ausgebildet hat, um in allen Sprachen des Landes – die im Übrigen alle als Amtssprachen anerkannt sind – zu unterrichten, ist es noch ein sehr weiter Weg.
Zweites Beispiel: Strom. Erklärtes Ziel des Staates ist es, alle Bürger*innen mit Strom zu versorgen. Wo eine Anbindung ans Netz schwierig bis unmöglich ist, verspricht der Staat Insellösungen mit Sonnenenergie. Solarpaneele für jedes Haus – darauf warten sie in Asunción de Quiquibey bisher vergeblich. Auch die staatliche Gesundheitsversorgung reicht nicht bis hierher: Wenn jemand ernsthaft krank wird, bleibt nur der Weg mit dem Boot nach Rurrenabaque; schnelle Hilfe gibt es im Notfall nicht. Eine Frau erzählt von häuslicher Gewalt. Auch da zeigt sich die Abwesenheit des Staates: Hilfe von außen gibt es bei derartigen Problemen nicht.
Dabei ist Asunción de Quiquibey mit seiner relativen Nähe zur Stadt noch gut angebunden. Sonntags fahren die Bewohner*innen zum Markt nach Rurrenabaque und verkaufen dort die Produkte, die sie anbauen, wie Bananen, Mais und Yuca. Die meisten anderen der Indigenen-Dörfer in Pilón Lajas sind wesentlich weiter abgelegen. Die Bewohner*innen leben abgeschieden und verlassen ihr Dorf nur selten. „Die Menschen dort sind viel ärmer, und sie haben viel schlechteren Zugang zu Versorgung“, sagt Alex Oscar Chad Lurizi von SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), der staatlichen Behörde, die sich um die Schutzgebiete kümmert.
Wie lange es so weitergehen kann, ist unklar
„Wir sind 28 Familien im Dorf“, sagt Lucía Canare, mit 57 Jahren eine der ältesten Frauen im Ort. Sie hat 12 Kinder zwischen 10 und 40 Jahren. Vier leben noch bei ihr, die großen haben das Dorf verlassen. Viele junge Bewohner*innen ziehen weg, nach Rurrenabaque oder La Paz zum Beispiel, auf der Suche nach Arbeit.
Das Leben hier sei ruhig, und was sie anbauen, reiche aus, sagt Lucía Canare. Doch wie lange es noch so weitergehen werde, sei unklar. Die Indigenen fühlen sich in ihrer Lebensweise bedroht – vor allem durch Dinge, die außerhalb ihrer Reichweite liegen, die mit Macht und Geld zu tun haben. Und auch hier vermissen sie die Unterstützung des Staates.
Das eine Thema ist der Goldabbau. Im bolivianischen Amazonasgebiet wird Gold mit Hilfe von Quecksilber gewonnen. Und auch wenn die Goldminen außerhalb des Schutzgebietes liegen, am Río Kaka zum Beispiel, vier Stunden per Boot von Asunción de Quiquibey entfernt, kommt das Quecksilber dennoch hier an. Die Menschen nehmen es vor allem über Fische auf, ein Grundnahrungsmittel der Flussanwohner*innen. Studien zeigen, dass die Menschen der Region ein Vielfaches dessen im Organismus haben, was von der Weltgesundheitsorganisation als unbedenklich angesehen wird. Der Körper kann das Schwermetall nicht abbauen, es lagert sich immer mehr an. Unter anderem schädigt es das zentrale Nervensystem; es kann zu Haarausfall führen, zum Erblinden und zu vielen weiteren Problemen.
Auch bei den Menschen in Asunción haben Wissenschaftler*innen Haarproben genommen. Die Dorfbewohner*innen kennen ihren Quecksilberwert, und sie haben Angst vor den Folgen. Und was tut der Staat? „Da herrscht totales Schweigen“, sagt Chad Lurizi von SERNAP. Die Behörden gingen weder gegen den Einsatz von Quecksilber vor, noch kümmerten sie sich um die gesundheitlichen Folgen.
Die andere große Angst hat mit einem gigantischen Infrastrukturprojekt zu tun, das seit Langem geplant, aber bisher nicht umgesetzt ist: Der bolivianische Staat will ein riesiges Wasserkraftwerk mit zwei Komponenten am Río Beni bauen, mit einer Gesamtkapazität von 3676 Megawatt. Die Pläne für das Projekt namens „El Bala“ reichen bis in die 1950er-Jahre zurück. Dass es bisher nicht gebaut wurde, ist vor allem dem vereinten Widerstand der Indigenen Völker der Region zu verdanken. Die mit Abstand größere Komponente, genannt „Chepete“ und rund 70 Kilometer flussaufwärts von Rurrenabaque gelegen, soll laut dem staatlichen Stromversorger ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) eine 183 Meter hohe Staumauer erhalten. Der so entstehende Stausee würde eine Fläche von 680 Quadratkilometern überschwemmen und wäre der zweitgrößte See Boliviens nach dem Titicacasee. Die zweite Komponente, „Bala“, mit einem Laufwasserkraftwerk, 13,5 Kilometer von Rurrenabaque entfernt, würde laut ENDE bis zu weitere 93 Quadratkilometer betreffen.
Für die Indigenen stellt das Wasserkraftwerk eine existenzielle Bedrohung dar. Ihren Vertreter*innen zufolge würden mehr als 5000 Menschen aus sechs Indigenen Gruppen ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage verlieren, unter ihnen auch die Bewohner*innen von Asunción de Quiquibey, das im Überflutungsgebiet liegt. Und wo sollten die Menschen dann hin? Es wäre das Ende ihrer Völker, so die Befürchtung, denen nach und nach der Lebensraum genommen wird. Noch besteht immerhin die Hoffnung, dass „El Bala“ nie gebaut wird.
Die Bedrohung kommt von vielen Seiten
Doch auch die Bodenschätze, die in Pilón Lajas lagern, wie Gold und Erdgas, bereiten den Einwohner*innen Sorge. „Nicht nur Leute aus Bolivien, auch ausländische Firmen, zum Beispiel aus Venezuela und China, haben Anträge gestellt, um sie auszubeuten“, sagt Clever Clemente Caimany aus Asunción de Quiquibey. Er ist Mitglied im Consejo Regional Tsimane Moseten (CRTM) Pilón Lajas, einer Vereinigung, die für den Erhalt der Biodiversität und den Schutz der Rechte der Ureinwohner*innen des Gebiets kämpft.
Eine weitere Bedrohung stellt die Landnahme dar. Menschen aus anderen Regionen Boliviens migrieren ins Tiefland und roden dort Wald, um Ackerfläche zu gewinnen. Davon bleiben auch die Schutzgebiete nicht verschont. Die Regierung des Movimiento al Socialismo (MAS), die noch bis Anfang November 2025 im Amt ist, drückt dabei oft ein Auge zu: Sie versteht sich zwar als Anwalt der Indigenen, aber dazu zählen eben insbesondere auch die Andenbewohner*innen, die in das Amazonasgebiet kommen. Und irgendwo müssen diese ja ihren Lebensunterhalt bestreiten, wenn die Bergwerke keine Arbeit mehr bieten, Wasserquellen ausgetrocknet oder verseucht sind und die Landwirtschaft, die dort schon immer schwierig war, kaum noch das Überleben sichert. So nehmen die Indigenen aus dem Hochland Lebensraum der Indigenen im Tiefland ein.
Letztere glauben klar zu erkennen, welche Gruppe bevorzugt wird: Wenn es politisch um die Rechte der Ureinwohner*innen Boliviens gehe, seien stets die aus den Anden gemeint, die große Mehrheit der Quechua und Aymara – nicht die kleinen Völker im Amazonasgebiet, die sich selbst als vom Aussterben bedroht ansehen.
Katja Dombrowski ist Journalistin mit entwicklungspolitischem Schwerpunkt und ehemalige Redakteurin von E+Z. Von August 2022 bis Januar 2025 arbeitete sie im Auftrag des Weltfriedensdienstes e.V. in Bolivien. Die Recherche für diesen Text fand im Rahmen dieser Arbeit statt.
kd@katja-dombrowski.info