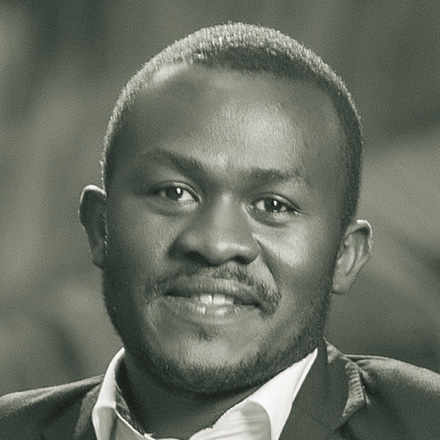Südasien
In Pakistan ist autoritäres Gebaren ein koloniales Erbe

Wenn Sozialwissenschaftler erklären wollen, weshalb sich Nationen unterschiedlich entwickelt haben, betonen sie gern Institutionen. Definieren lassen diese sich als „soziale Erwartungen“ oder auch als „formale und informelle Regeln“. Es gibt eine große Vielfalt von Institutionen, von der Ehe bis zur Justiz.
Institutionen sind langlebig, denn soziale Erwartungen bestätigen sich oft selbst. Gute wie schlechte Institutionen bleiben beständig. Von Menschen geschaffen, können sie auch von Menschen verändert werden, was in graduellen Reformen etwa des Familienrechts geschehen kann, aber auch durch plötzliche Revolution oder Krieg. Die Kolonisierung von Amerika, Asien und Afrika durch Europäer vom 16. bis zum 19. Jahrhundert hinterließ institutionelle Spuren, die postkoloniale Staaten bis heute prägen.
Was Punjab den Briten bedeutete
Indien war wirtschaftlich und politisch die wichtigste Kolonie des British Empire. In ihr spielte Punjab eine besondere Rolle, denn das ehemalige Sikh-Königreich war wirtschaftlich bedeutend und militärisches Rekrutierungsfeld.
Punjab war die letzte große Region, welche die East India Company in Südasien eroberte, und zwar in den beiden Anglo-Sikh-Kriegen von 1846 und 1849. Danach wollten die Briten die Gesellschaft zunächst entmilitarisieren, um jeglichem Widerstand vorzubeugen. Sie änderten ihre Haltung aber bald.
1857 rebellierte nämlich die Bengal Army, die für die East India Company die wichtigen Feldzüge in Nordindien geführt hatte. Aus Sicht der Kolonialmacht war es eine Meuterei, aber Historiker sprechen heute von einem fehlgeschlagenen frühen Unabhängigkeitskrieg.
Es gelang den Kolonialherren, die Rebellion niederzuschlagen, wofür sie aber Hilfe aus Punjab brauchten. Angesichts des Aufstandes wirkten die Punjabis weniger gefährlich, und die Briten begannen, die ökonomische und militärische Elite der Region zu kooptieren. Diese nutzte die Chance, ihre gesellschaftliche Stellung und ihren Wohlstand neu zu sichern.
Rekrutierungsgebiet
Das britische Militär rekrutierte Soldaten jetzt nicht mehr wie zuvor für die in Misskredit gefallene Bengal Army aus den höheren Kasten. Bald schon pries es die kräftigen Körper und das „ehrbare Verhalten“ der Männer aus Punjab. Es hieß, sie seien als Angehörige „kriegerischer Rassen“ für den Militärdienst besonders geeignet.
Von 1858 bis in die 1880er Jahre wurden ständig mehr Soldaten im Punjab rekrutiert. Die Armee sollte ganz Britisch-Indien sichern und verhindern, dass die Macht des Empire infrage gestellt würde.
Dann erfasste jedoch eine neue Sorge die Briten. Das Zarenreich wurde ehrgeiziger, und was heute Afghanistan ist, wurde umkämpft. Das Kolonialheer sollte nunmehr nicht nur im Reich Stabilität sichern, sondern auch einer möglichen russischen Invasion standhalten können.
Rassistische Vorstellungen vom kriegerischen Naturell wurden noch wichtiger. Besonders schätzten die Briten Muslime aus der Gegend Salt Range, Sikhs aus dem Zentralpunjab und hinduistische Jats aus dem östlichen Punjab.
Macht und Grundbesitz
Punjab war mit hohen Agrarüberschüssen auch ökonomisch bedeutsam. Neue Wasserinfrastruktur erwies sich vor allem für Familien mit großem Landbesitz als wertvoll. Es entstanden Staudämme, Kanäle und Bewässerungsanlagen.
Das Herrschaftssystem war autoritärer Paternalismus. Auf der lokalen Ebene stand der Grundbesitz der Eliten für die Macht des Empires. Im Ersten Weltkrieg wurden noch mehr Punjabis zum Militär eingezogen, um in Europa zu kämpfen. Für die Soldaten und ihre Familien bedeutete das die Aussicht auf Einkommen und Pensionsansprüche. Für die grundbesitzende und militärische Elite war es aber die Chance, ihre Loyalität zu demonstrieren, wofür sie mit Anerkennung und weiteren Ländereien belohnt wurde.
Anderswo in Südasien entstanden nationalistische Bewegungen. Darauf folgten ein paar Reformen mit recht kleinen Schritten in Richtung Demokratie. In geringerem Maß wurde den Regionen Selbstverwaltung zugestanden.
Weil gebildete städtische Schichten besonders deutlich die Unabhängigkeit forderten, wurden Wahlkreise so zugeschnitten, dass Dörfer unverhältnismäßig hohen Einfluss hatten. In Punjab dominierte die loyale Unionist Party. Sie war ein interreligiöses Bündnis von Offizieren mit landbesitzenden muslimischen Sikh- und Hindu-Eliten.
Bis zum Zweiten Weltkrieg funktionierte das System für die Briten gut, aber dann gab eine harte Wirtschaftskrise der Unabhängigkeitsbewegung neuen Auftrieb. Diese spaltete sich allerdings identitätspolitisch, weil sich die Muslim League von der Kongresspartei absetzte.
Teilungstrauma
1947 wurde Britisch-Indien in das überwiegend hinduistische Indien und Pakistan als muslimisches Land aufgespalten. Die beiden wichtigen Regionen Punjab und Bengalen wurden ihrerseits geteilt. Der Westen Punjabs wurde zu einem Teil Westpakistans, und Ostbengalen auf der anderen Seite des Subkontinents wurde Ostpakistan.
Laut konservativen Schätzungen starben mehr als eine Million Menschen in den gewalttätigen Auseinandersetzungen, welche die Teilung auslöste. Mehr als 15 Millionen wurden vertrieben. Die scheidende Kolonialmacht hatte nichts, um einen friedlichen Übergang sicherzustellen.
Dass die landwirtschaftlich und militärisch wichtigste Provinz Punjab die schlimmste Brutalität erlebte, war kein Zufall. Seither belastet tiefsitzendes Trauma die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den Nachfolgestaaten des Empires.
Die schädliche Macht des Militärs
Der postkoloniale Staat Pakistan hatte von Anfang an eine Grundbesitzelite, die sich an ihre Allianz mit den Machthabern gewöhnt hatte. Wie zuvor konnte sie auf dieser Basis die Menschen in den Dörfern beherrschen. Rassistische Vorstellungen von einer besonderen Kämpfernatur wurden weiter gepflegt, wobei nun die indische Bedrohung mit ins Spiel kam. Im Kalten Krieg näherte sich das offiziell blockfreie Indien der Sowjetunion an, sodass Pakistans postkoloniale Elite sich für die USA entschied.
Das Bündnis mit dem Westen führte aber nicht zu substanzieller Demokratisierung. Vielmehr bestand das oligarchische Bündnis von Militär und Grundbesitz fort. Es begrenzte den Einfluss gewählter Politiker – wenn nötig mit Militärputschen. Der Staat gab Militärausgaben die Priorität, Entwicklung blieb zweitrangig.
Die postkoloniale Dominanz des Militärs erwies sich immer wieder als dysfunktional. Besonders offensichtlich wurde das, als die Generäle verhinderten, dass der ostpakistanische Politiker Sheikh Mujibur Rahman Premierminister wurde, obwohl dessen Awami League die Wahlen gewonnen hatte. Nach einem kurzen, blutigen Krieg wurde aus Ostpakistan der souveräne Staat Bangladesch.
Das Militär hatte nicht nur legitime bengalische Anliegen ignoriert, sondern sogar versucht, jegliche Opposition zu zerschlagen. Dass die Niederlage seinen Einfluss in Pakistan nicht minderte, zeigt, wie persistent Institutionen sein können.
Vielfältige soziale Bewegungen haben die Herrschaft der Oligarchie in Pakistan infrage gestellt, aber nicht beschädigt. Teils beruht seine Stärke auf imperialen Verbindungen. In den 1980er Jahren wurde Pakistan abermals wegen der sowjetischen Besatzung Afghanistans zu einem Frontstaat. Das setzte sich später auch wegen des von den USA proklamierten „globalen Kriegs gegen den Terror“ fort.
Mit einem Teil des hereinströmenden Geldes schuf sich das Militär ein großes Firmenimperium. Es ist heute der wichtigste Akteur in Pakistans Wirtschaft. Das Bündnis mit dem Westen verfestigte so das Kolonialerbe, welches das Militär zur zentralen Macht im Staate hatte werden lassen.
Permanente Herrschaft
Zeitweilig regierten Militärjuntas Pakistan. Selbst wenn danach die Demokratie offiziell wieder eingeführt wurde, blieben jedoch die Generäle entscheidende Akteure, gegen deren Wünsche keine Politik zu machen war. In Randregionen gab es immer wieder Widerstandsbewegungen, die aber die Dominanz des Militärs kaum beeinträchtigten.
Die Stärke dieses Systems lässt sich daran ablesen, wie es mit Imran Khan, dem derzeit beliebtesten Politiker, umgeht. Er war zwar früher der stärkste Befürworter des Militärs, geriet dann aber als Premierminister von 2018 bis 2022 mit ihm in Konflikt. Das Parlament enthob ihn des Amts, und bei der Wahl in diesem Februar durfte seine Partei nicht antreten. Wegen fadenscheiniger Vorwürfe sitzt er seit über einem Jahr im Gefängnis.
Dennoch waren viele seiner Parteiangehörigen – nominell als „Unabhängige“ – bei der Wahl erfolgreich. Trotz deutlicher Anzeichen von Wahlmanipulationen gewannen sie fast ein Drittel der Stimmen, mehr als jede Partei. Mit 93 von 272 Sitzen im Parlament sind sie nun die Opposition.
Eine Koalition aus vielen Parteien wurde gegen sie geschmiedet. Diese genießt keine breite Unterstützung im Volk, aber vom Militär. Dass Letzteres mehr zählt als Wählerstimmen, ist ein koloniales Erbe und erschwert Pakistans Entwicklung erheblich.
Muhammad Nawfal Saleemi ist Dozent für Geschichte und Politik an der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Lahore University of Management Sciences.
muhammad.saleemi@lums.edu.pk