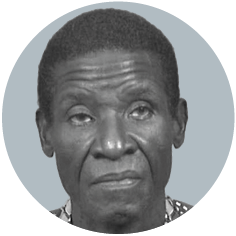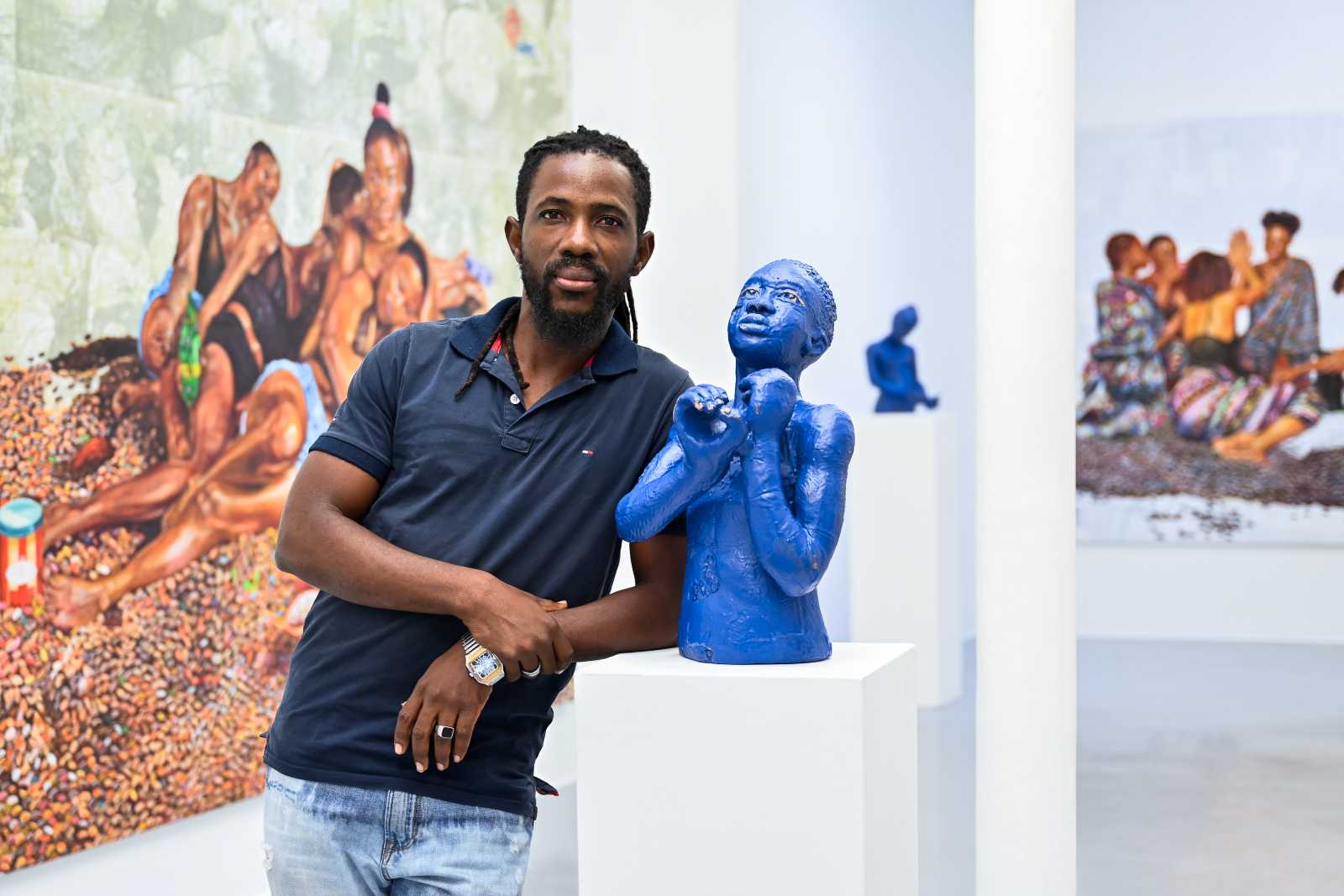Governance
Lehren für die Demokratie aus Südafrika und Äthiopien

Südafrikas Übergang aus der Apartheid im Jahr 1994 führte zur Gründung einer der stabilsten konstitutionellen Demokratien Afrikas, die auf Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und regelmäßigen Wahlen basiert. Drei Jahrzehnte später steht die Demokratie jedoch massiv unter Druck. Die Wahlen im Jahr 2024 markierten einen Wendepunkt: Der African National Congress (ANC) erlitt seine schlimmste Wahlniederlage und erzielte erstmals seit 1994 keine parlamentarische Mehrheit. In diesem Wandel zeigt sich die wachsende Frustration der Bevölkerung über Korruptionsskandale, wirtschaftliche Stagnation und Versäumnisse der Regierung.
Der Aufstieg populistischer Bewegungen, insbesondere der Economic Freedom Fighters (EFF) und der Partei uMkhonto weSizwe (MK) des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, hat die politische Spaltung verschärft. Diese Parteien nutzen wirtschaftliche und historische Missstände aus und erschweren damit zunehmend eine konsensorientierte Regierungsführung. Korruption und Misswirtschaft führen zudem dazu, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Institutionen verliert, was die demokratische Stabilität zusätzlich schwächt. Trotz dieser Herausforderungen verfügt Südafrika nach wie vor über institutionelle Schutzmechanismen wie eine unabhängige Justiz und eine aktive Zivilgesellschaft. Diese können zur Überwindung der demokratischen Krise beitragen – sofern die politische Führung Reformen und Rechenschaftspflicht priorisiert.
Auch Äthiopiens demokratischer Kurs ist deutlich instabiler geworden. Abiy Ahmeds Aufstieg zum Premierminister 2018 und der Friedensnobelpreis, den er ein Jahr später insbesondere für seine Politik der Versöhnung mit dem Nachbarland Eritrea erhielt, signalisierten zunächst einen Bruch mit der autoritären Vergangenheit des Landes und versprachen politische Liberalisierung. Dieser Optimismus schwand jedoch schnell, als die Regierung zu Repression, Zensur und zentralistischer Kontrolle zurückkehrte.
Die Wahlen von 2021 – von Wählerunterdrückung und Konflikten überschattet – unterstrichen Äthiopiens demokratischen Rückschritt. Teile der Bevölkerung wurden vom Wahlprozess ausgeschlossen, und wichtige Oppositionspersönlichkeiten wurden verhaftet. Die Wahlen waren somit weder frei noch fair.
Zudem hat das ethnisch-föderalistische System Äthiopiens, ursprünglich dazu gedacht, Macht zu dezentralisieren, in Wirklichkeit ethnische Spaltungen und Instabilität verschärft und gewaltsame Konflikte ausgelöst. Äthiopien hatte den ethnischen Föderalismus eingeführt und die Regionen des Landes anhand ethnischer Grenzen umstrukturiert, nachdem die Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) 1991 die Macht übernommen und die Militärjunta gestürzt hatte.
Erkenntnisse für die Zukunft der Demokratie in Afrika
Aus den Erfahrungen von Südafrika und Äthiopien lassen sich wichtige Erkenntnisse für demokratische Regierungsführung in ganz Afrika ableiten.
Erstens: Institutionen allein reichen nicht. Um die Demokratie aufrechtzuerhalten, braucht es unbedingt politischen Willen und bürgerschaftliches Engagement. Südafrika hat weiterhin eine intakte, unabhängige Justiz und eine freie Presse, aber ohne proaktive Reformen wird die zunehmende Polarisierung diese schwächen. In Äthiopien haben schwache Institutionen eine autoritäre Konsolidierung ermöglicht, in der wenig Raum für demokratische Debatten bleibt.
Zweitens: Wahlen sind kein Garant für Demokratie. Der Wahlprozess in Äthiopien hat gezeigt, dass Wahlen ohne Transparenz und politischen Wettbewerb nur symbolischer Natur sind. Selbst in Südafrika zeigt das sinkende Vertrauen der Wählerschaft, dass reine Verfahrensdemokratie nicht ausreicht – politisch Verantwortliche müssen rechenschaftspflichtig sein und auf die Anliegen der Öffentlichkeit eingehen.
Drittens: Politische Polarisierung und ethnische Spaltung sind existenzielle Bedrohungen für die Demokratie. In Südafrika birgt populistische Rhetorik die Gefahr, demokratische Normen zu untergraben, während in Äthiopien der ethnisch geprägte Föderalismus die Konflikte eher verschärft hat, als Integration zu fördern. Entscheidend sind in beiden Fällen inklusive Regierungsführung und das Bemühen, soziale Spaltungen zu überwinden.
Afrikas demokratische Zukunft hängt davon ab, wie widerstandsfähig seine Institutionen sind und wie sehr sich politisch Verantwortliche und Zivilgesellschaft für die Wahrung demokratischer Prinzipien engagieren. Südafrika verfügt nach wie vor über den institutionellen Rahmen, um die aktuelle Krise zu überwinden – vorausgesetzt, es führt Reformen durch, um das öffentliche Vertrauen wiederherzustellen und die Korruption einzudämmen. Äthiopien hingegen benötigt eine grundlegende politische Umstrukturierung, um eine weitere Erosion der Demokratie und noch mehr Instabilität zu verhindern.
Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie erfordert Wachsamkeit, Reformen und eine aktive Beteiligung der Bürger*innen. Die Erfahrungen Südafrikas und Äthiopiens zeigen, dass demokratischer Fortschritt möglich, aber fragil ist. Wollen Afrikas Demokratien überleben, so müssen sie nicht nur ihre Institutionen verteidigen, sondern auch ein politisches Umfeld schaffen, in dem Inklusion, Rechenschaftspflicht und Rechtsstaatlichkeit im Mittelpunkt stehen.
Hafte Gebreselassie Gebrihet ist Postdoctoral Research Fellow an der Nelson Mandela School of Public Governance an der Universität Kapstadt (UCT). Er erforscht insbesondere den Aufbau demokratischer Regierungsführung und resilienter Institutionen in Afrika, besonders hinsichtlich der UN-Agenda 2030 und der Afrika-Agenda 2063.
hafte.gebrihet@uct.ac.za