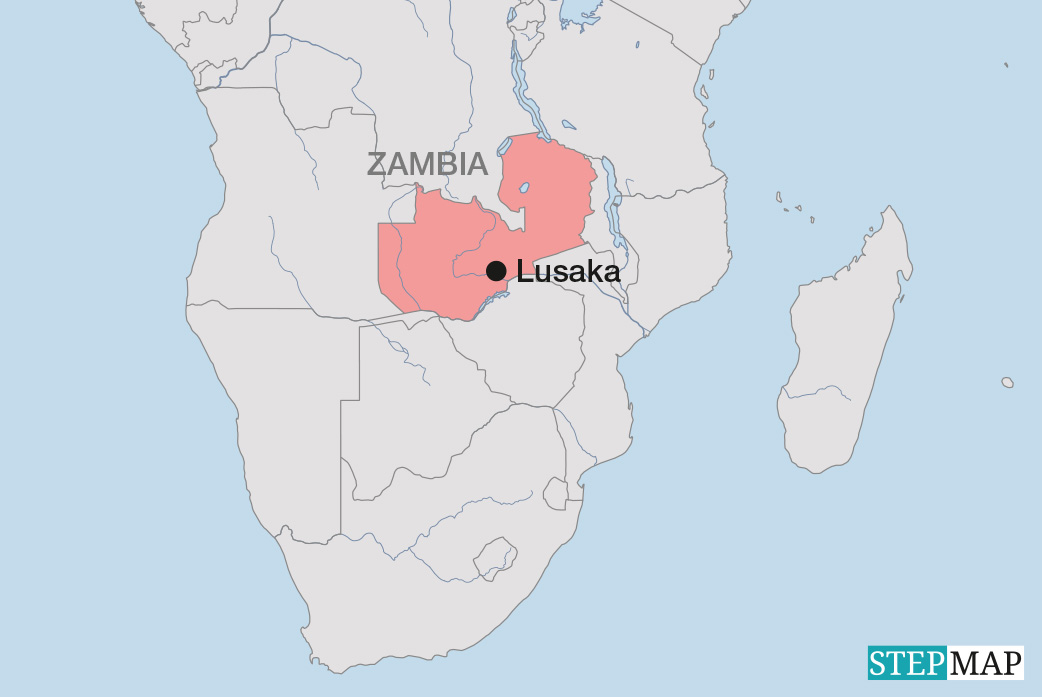Innerafrikanische Migration
Unwillkommen im Nachbarland

Als Robert Mugabes militante Regierung im Jahr 2000 begann, Farmen weißer Besitzer*innen in Simbabwe entschädigungslos zu beschlagnahmen, löste dies Währungsverfall, Nahrungsmittelknappheit und Hyperinflation aus. Diese turbulente Zeit markierte den Beginn einer Massenmigration nach Südafrika, wobei qualifizierte Arbeitskräfte, insbesondere Lehrer*innen, zusätzlich von den Anwerbebemühungen des Nachbarlandes angezogen wurden.
„Der Ansturm begann in den frühen 2000er-Jahren. Viele wollten unbedingt nach Südafrika, weil es dort lukrative Jobs gab. Zuerst gingen die Lehrer*innen, dann Handwerker*innen, dann Krankenpfleger*innen“, erinnert sich Pious Soko, der 2007 nach Südafrika kam. Der Apotheker lebt in Johannesburg und hat jetzt eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung.
Aber die 2000er-Jahre waren nicht das erste Mal, dass Menschen aus Simbabwe in Scharen nach Südafrika gingen. „Als der koloniale Buschkrieg in Simbabwe – damals Rhodesien – 1980 endete, strömten Tausende weiße Simbabwer*innen nach Kapstadt. Mugabe gewann die Wahlen, und sie wollten nicht von einem schwarzen Präsidenten regiert werden“, sagt Kudakwashe Magezi, ein simbabwischer Politologe. Das südafrikanische Apartheidregime musste jedoch erst fallen, bevor die eigentliche Massenmigration schwarzer Simbabwer*innen nach Südafrika begann.
Sulla Badza beschreibt ihre Ankunft in Südafrika im Jahr 2002 als „sanfte Landung“. Die aus Harare eingewanderte Physiklehrerin kam wegen der vielen verfügbaren High-School-Jobs. „Das Land schwelgte noch in der Euphorie der Post-Mandela-Ära. Aber die lokale schwarze Bevölkerung hatte kaum Universitätsabschlüsse, und Lehrkräfte waren so rar, dass sogar Englischlehrer*innen manchmal Buchhaltung unterrichteten. Wir waren willkommen“, erinnert sie sich. „Der südafrikanische Rand war fast so viel wert wie der US-Dollar, die Strom- und Wasserversorgung war zuverlässig, und die Straßenlaternen wurden nicht von Schrottdieben gestohlen“, erzählt Badza.
Zwischen 2000 und 2005 erhielten Tausende Simbabwer*innen eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und in einigen Fällen auch die Staatsbürgerschaft. Gleichzeitig waren viele gefälschte Ausweise und Pässe im Umlauf, manchmal auch unter Beihilfe korrupter südafrikanischer Staatsbeamte*innen.
Inflationsbedingte Migration
Ab 2007 wurde Simbabwe von einer Hyperinflation historischen Ausmaßes getroffen, und das, was von der funktionierenden Industrie des Landes übriggeblieben war, wurde zerstört. Im Jahr 2008 war der Simbabwe-Dollar praktisch wertlos, und man brauchte eine Schubkarre voll Geldscheine, um einen Laib Brot zu kaufen. Als 2008 Wahlen anstanden, schien es, als würde die Opposition die Regierungspartei, die das Land seit 1980 regiert hatte, ablösen. Die staatlich geförderte Gewalt gegen diese Opposition nahm erschreckende Ausmaße an. Damit begann die nächste Massenmigration nach Südafrika.
Doch die Wirtschaft Südafrikas war nicht mehr dieselbe. Jacob Zuma übernahm 2009 das Präsidentenamt, und die Korruption florierte im Land. Der Rand verlor gegenüber dem US-Dollar an Wert. Die Jugendarbeitslosigkeit schnellte in die Höhe.
Pedzisayi ist ein Migrant ohne Papiere, der in einem Township von Pretoria eine Mechanikerwerkstatt betreibt. Seinen Nachnamen möchte er nicht nennen. „Die Feindseligkeit gegenüber Migrant*innen aus Simbabwe nahm ab 2008 zu. Wir spürten eine wachsende Wut – Diebstähle, Raubüberfälle, Vergewaltigungen und die Vermüllung der Straßen wurden uns angelastet“, erinnert sich Pedzisayi. „Wenn Bettler*innen an der Ampel standen, wurden sie als Simbabwer*innen abgestempelt. Wurde in einen Supermarkt eingebrochen, beschuldigte man Simbabwer*innen. Vermieter*innen wurden unter Druck gesetzt, keine Zimmer an Simbabwer*innen zu vermieten. Die Südafrikaner*innen dachten, wir nähmen ihnen die Arbeitsplätze weg.“
Die erste Einwanderungswelle brachte Angestellte für Südafrikas Universitäten, Schulen, Regierungsbüros und Laboratorien. Nun kamen tausende gering qualifizierte Arbeitskräfte, oft ohne Papiere, die ihren Lebensunterhalt als Bergleute, Gemüse- und Hühnerverkäufer*innen auf den Straßen Johannesburgs oder als Haushaltshilfen in überwiegend weißen Haushalten in Kapstadt verdienten. „Die öffentliche Wahrnehmung war, dass diese gering qualifizierten Einwanderer arme Südafrikaner*innen verdrängten und die Sozialdienste überlasteten“, sagt der simbabwische Wirtschaftswissenschaftler Carter Mavhiza.
Ein Jahrzehnt der Feindseligkeit
Flächendeckendes Internet kam zu dieser Zeit in Südafrika auf und schürte die Ressentiments gegen Migrant*innen weiter, da sich der Hass auch online verbreitete. Im Mai 2008 ereigneten sich schließlich erschütternde Szenen, als ein Mob von Einheimischen aus Johannesburgs Alexandria Township begann, Migrant*innen aus Simbabwe, Malawi und Mosambik zu attackieren.
Dutzende Migrant*innen wurden in ihren Häusern aufgespürt, gelyncht, ausgeraubt und getötet. Die schlimmsten Szenen fremdenfeindlicher Gräueltaten waren die Bilder von Ernesto Nhamuave, einem Mosambikaner, der in Alexandria vor laufenden Fernsehkameras verbrannt wurde.
„Wir begannen, uns mit falschen, südafrikanisch klingenden Namen anzumelden, um nicht Gefahr zu laufen, als simbabwisch erkannt zu werden. Für Jobs im Restaurant übten wir, mit südafrikanischem Akzent zu sprechen“, berichtet Gadzi, eine simbabwische Gemüsehändlerin, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte.
Die regierende südafrikanische Partei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) verschärfte ab 2010 die Einwanderungsgesetze, und immer mehr simbabwische Akademiker*innen und Lehrkräfte wurden entlassen, um Platz für schwarze Südafrikaner*innen zu schaffen, die in großer Zahl die Universitäten verließen. Mit den neuen Gesetzen begann ein Jahrzehnt intensiver Feindseligkeit gegen alle Teile der simbabwischen Bevölkerung, die bis heute anhält.
Nach südafrikanischem Recht haben Einwandernde mit oder ohne Papiere freien Zugang zu öffentlichen Krankenhäusern und Schulen. In der Realität jedoch ist die Feindseligkeit in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens zu spüren. Sibongile Jongwe ist eine simbabwische Mutter von drei Kindern, die ihren Lebensunterhalt als Reinigungskraft in Sandton, Johannesburgs reichstem Vorort, verdient. Sie berichtet: „Mir wurde gesagt, ich müsse ein Bestechungsgeld von 4000 Rand (200 Dollar) zahlen, um einen Platz für die Geburt in einem öffentlichen Krankenhaus bekommen. Ein Dutzend anderer schwangerer Migrantinnen, die ich kenne, wurden aufgefordert, das Gleiche zu tun.“
Operation „Force Out“
In den letzten fünf Jahren sind in Südafrika neue politische Parteien auf den Plan getreten, die hoffen, dass sich Ressentiments gegenüber Einwanderern bei den Wahlen auszahlen könnten. Eine Schlüsselfigur ist Herman Mashaba, ein ehemaliger Bürgermeister von Johannesburg und jetzt Vorsitzender der Partei Action South Africa. Ihr Hauptziel ist die Abschiebung aller Ausländer ohne Papiere. Solche einwanderungsfeindlichen Parteien haben in allen südafrikanischen Provinzen ein großes Publikum gefunden. Die zunehmend verarmte Bevölkerung sieht in den Migrant*innen eine Ursache für ihre Probleme. Einige fremdenfeindliche Gruppen haben sich zu Bewegungen wie der Operation Dudula (Operation „Force Out“) entwickelt, die sich sowohl gegen legale als auch illegale Migrant*innen richtet.
Die Feindseligkeit geht inzwischen über die Generationengrenzen hinaus. Der Apotheker Pious Soko hat sie nach mehr als 15 Jahren in Südafrika erlebt: „Ein simbabwisches Kind, das in Südafrika geboren wurde und nie einen Fuß auf simbabwisches Gebiet gesetzt hat, bekommt jeden Tag in der Schule zu hören: Du bist nicht südafrikanisch.“
Audrey Simango ist freiberufliche Journalistin und arbeitet in Südafrika und Simbabwe.
thefoodradio@gmail.com