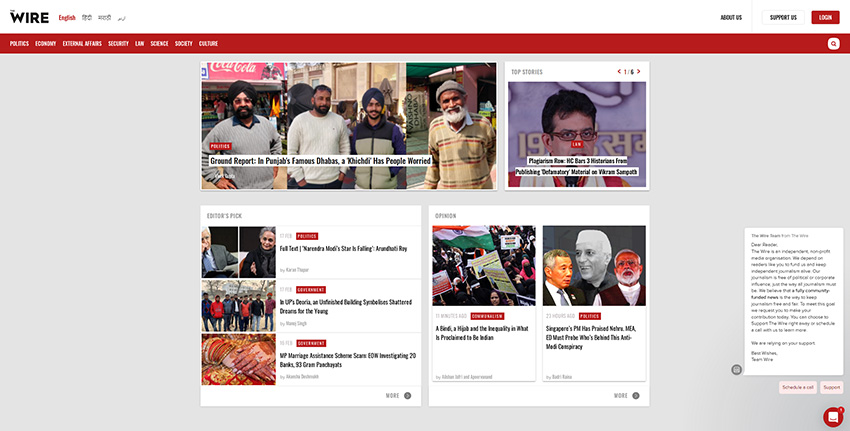Bedrohter Pluralismus
Beschädigte Demokratie

Es stört Jan-Werner Müller, dass der Begriff „Populismus“ meist ohne präzise Definition verwendet wird. Der deutsche Politikprofessor von der Princeton University schlägt in seinem Buch „Was ist Populismus?“ (2016) eine Bedeutung vor. Entscheidend ist für ihn, dass Populisten beanspruchen, die einzigen legitimen Repräsentanten „des“ Volks zu sein. Das ist implizit undemokratisch, denn keine Nation ist homogen. In jeder Gesellschaft gibt es schließlich unterschiedliche und widerstreitende Interessen.
In Demokratien vertreten unterschiedliche Parteien unterschiedliche Interessen, und Regierungspolitik ist das Ergebnis kontroverser Debatten, wobei Mehrheiten auf Bündnissen verschiedener Interessengruppen beruhen. Unterschiedliche Sichtweisen sind wichtig, breite Debatten erwünscht und Opposition gegen Regierungspolitik legitim.
Müller zufolge bestreiten aber Populisten, dass es divergierende Interessen gibt, und tun so, als sprächen sie für ein homogenes Volk, das von einer eigentümlichen Allianz der Elite mit vom Sozialstaat verwöhnten Minderheiten ausgebeutet wird. Weil detaillierte Diskussionen von Reformkonzepten nicht ihrer polarisierenden Rhetorik dienten, ließen sie sich gar nicht darauf ein.
Müller stellt klar, dass die Populisten selbst definieren, wer zur Nation gehört und wer nicht. Je nach Situation änderten sie diese Definition auch. Immer beanspruchten sie aber zu wissen, was „die“ Leute wollen. Populisten forderten Anerkennung und Gefolgschaft, werteten aber Kritik an sich als Angriff auf „das” Volk.
Müller räumt ein, dass sein Populismus-Begriff nicht dem konventionellen Verständnis in Nordamerika entspricht. Dort vertraten „Populists“ früher die Interessen der Farmer im ländlichen Raum gegenüber Banken und Eisenbahngesellschaften. Sie kritisierten die Großunternehmen heftig, gestanden ihnen aber eine Rolle zu.
Die heutigen Populisten, um die es Müller geht, bestehen dagegen darauf, nur sie wüssten, was die Nation wolle, und folglich könne auch niemand anderes richtig regieren. Das Versprechen nationaler Harmonie ist aber Müller zufolge nicht erfüllbar, weil es unvermeidliche Interessensunterschiede übertüncht. Unfähig, ihre Ankündigungen auch wahr zu machen, blieben Populisten deshalb selbst nach Wahlerfolgen aggressiv und agitierten wütend gegen Sündenböcke: gerade so, als scheitere ihre großartige Agenda an all denen, die ihnen widersprechen.
Aus Sicht des Politikwissenschaftlers bedeutet es immer eine Verfassungskrise, wenn Populisten an die Macht kommen. Solange sie in der Opposition seien, sähen sie überall Korruption und Vetternwirtschaft, aber im Amt griffen sie selbst zu diesen Methoden und sprächen von „Selbstverteidigung“. Zudem neigten sie dazu, Gesetze und selbst die Verfassung zu ändern, um auf Dauer an der Macht zu bleiben. Im Bemühen, alle staatlichen Posten zu besetzen, beschränkten sie dann auch die Medienfreiheit und den Raum für zivilgesellschaftliches Engagement. Laut Müller könnten sie sich nur an der Macht halten, solange es ihnen gelingt, sich als die Vertreter der schweigenden Mehrheit zu verkaufen, die für das permanent bedrohte „echte“ Volk kämpfen.
Wenn Populisten regieren, ist aus Müllers Sicht die Demokratie beschädigt, aber nicht unbedingt am Ende. Entscheidend ist, ob Zivilgesellschaft, Medien und diverse Institutionen stark genug sind, Gegendruck zu machen und die Zentralisierung der Staatsgewalt zu verhindern.
Es heißt oft, Populisten zögen Modernisierungs- und Globalisierungsgewinner an. Müller widerspricht, denn tatsächlich fänden Populisten Anklang in vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Besonders für Menschen mit sozialdarwinistischen Vorstellungen seien sie attraktiv.
In der Auseinandersetzung mit Populisten kommt es darauf an, Pluralismus, Vielfalt und breite gesellschaftliche Debatten zu betonen. Wie Müller ausführt, haben aber die Regierungen vieler westlicher Staaten – nicht nur, aber besonders in der EU – in den vergangenen Jahren behauptet, zu ihren technokratischen Konzepten gebe es keine Alternative. Auch diese Haltung findet Müller undemokratisch. Obendrein nutze sie den Populisten, die sich als einzige Alternative präsentieren könnten.
Schwächer werdende Demokratie
Colin Crouch ist ein britischer Soziologe, der ähnlich argumentiert. Dass übertriebener, technokratischer Marktenthusiasmus die Demokratie aushöhlt, schrieb er in seinem Buch „Post-democracy“ (2004). Ihm zufolge ist die Demokratie in westlichen Nationen seit den 1970er Jahren schleichend schwächer geworden. Der Buchtitel führt aber etwas in die Irre, denn er schreibt nicht, die Demokratie sei beendet – sondern nur, sie habe ihren Höhepunkt überschritten.
Es geht ihm nicht darum, dass Wahlen manipuliert oder andere demokratische Grundsätze verletzt worden seien. Er stellt aber fest, dass die Partizipation am öffentlichen Leben zurückgehe, was sich etwa in der Wahlbeteiligung niederschlage. Gewerkschaften, Kirchen und andere Großorganisationen verlören zudem Mitglieder und Einfluss. Aus Crouchs Sicht ist der vielfältige Aktivismus vieler kleiner Bürgerinitiativen zwar wertvoll, aber kein Ersatz für erodierende Großorganisationen. Die Anliegen der unteren Schichten würden ignoriert, egal welche Partei gerade regiere.
Der Frankfurter Sozialwissenschaftler Oliver Nachtwey kommt in seinem aktuellen Buch „Die Abstiegsgesellschaft“ mit Blick auf Deutschland zu einer noch düsteren Einschätzung. Ihm zufolge prägen Abstiegssorgen heute die ganze Gesellschaft. Zunehmend prekär werde nicht nur die Lage abgehängter Bevölkerungsgruppen sondern der breiten Mehrheit.
Nachtwey führt aus, dass der deutsche Sozialstaat anders als in der Vergangenheit nicht mehr den Lebensstandard der Bürger sichert. Immer mehr Menschen arbeiteten auf der Basis von Zeitverträgen oder als Freiberufler ohne die Sicherheiten der Festanstellung. Letztere bedeute heute auch nicht mehr lebenslange Beschäftigung. Alle wüssten, dass in der nächsten Krise Stellen gestrichen würden.
Reduzierte Unterstützung für Arbeitslose und abgesenkte Rentenniveaus verstärken laut Nachtwey soziale Sorgen. Erschwerend komme hinzu, dass die subventionierten Riester-Verträge nicht im versprochenen Maße die Abschläge bei der Alterssicherung ausglichen. Das nähre die Angst vor Altersarmut – während zugleich die heranwachsende Generation weniger Karrierechancen habe, als es die der Eltern gehabt habe.
Nachtwey erklärt, warum viele Deutsche Sehnsucht nach vergangenen Sicherheiten haben. Der Autor lässt keinen Zweifel daran, dass Populisten solche Sorgen ausnutzen können – und zwar in fast allen Bevölkerungsschichten. Ähnliche – meist sogar härtere – gesellschaftliche Trends prägen andere europäische Länder. Aus Nachtweys Sicht ist die große Frage, ob die Regierungen Konzepte finden, die wieder mehr soziale Sicherheit bringen. Großartige Visionen sind nicht gefragt, denn es kommt auf die Details der Politik an. Versagen wird allerdings sicherlich die gesellschaftliche Unterstützung für international ausgerichtete Entwicklungspolitik reduzieren.
Literatur
Crouch, C., 2004: Post-democracy. Cambridge/Malden, MA: Polity Press (auf Deutsch: Postdemokratie. Frankfurt: Suhrkamp, 2008).
Müller, J.-W., 2016: Was ist Populismus? Berlin: Suhrkamp (Auf Englisch: What is populism?. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016).
Nachtwey, O., 2016: Die Abstiegsgesellschaft (The society of downward mobility – only available in German). Berlin: Suhrkamp.